Nichts mehr verpassen und Blog abonieren!
„Wenn die Biene einmal von der Erde verschwindet, hat der Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.“
Albert Einstein

„Die Wertvollen Tropfen an der Spitze des Stachels“
Bienengift, das natürliche Produkt der Honigbiene, ist mehr als nur das, was bei einem Stich auf der Haut passiert. Es hat sich über Jahrhunderte hinweg als ein mächtiges Heilmittel in der Naturheilkunde etabliert, und immer mehr wissenschaftliche Studien beschäftigen sich mit den potenziellen medizinischen Vorteilen dieses Substanzcocktails. Doch was steckt hinter der geheimnisvollen Flüssigkeit, die Bienen in die Welt tragen?
Was ist Bienengift?
Bienengift besteht aus einer Vielzahl biologisch aktiver Substanzen. Hauptbestandteile sind Melittin, ein Peptid, das zu den wichtigsten und am stärksten wirksamen Bestandteilen gehört, sowie Apamin, eine weitere Peptidverbindung, die neurotoxische Eigenschaften hat. Darüber hinaus enthält Bienengift Enzyme wie Phospholipase A2, die entzündungshemmend wirken können, und Hyaluronidase, die das Eindringen von Giftstoffen in das Gewebe erleichtert. Diese Zusammensetzung macht Bienengift zu einem vielseitigen und komplexen Wirkstoff, dessen therapeutisches Potenzial in der modernen Medizin zunehmend untersucht wird.

Die medizinische Nutzung von Bienengift hat ihre Wurzeln in der traditionellen Heilkunde, doch mittlerweile gibt es eine Vielzahl wissenschaftlich fundierter Studien, die die Wirksamkeit in verschiedenen medizinischen Bereichen untersuchen. Besonders bemerkenswert ist der Einsatz von Bienengift in der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen, Schmerzlinderung und Autoimmunerkrankungen. Die bekannteste und wohl am weitesten verbreitete Form der Behandlung ist die Apitherapie, die Heilkunst mit Bienenprodukten, die seit Jahrhunderten in verschiedenen Kulturen angewendet wird.
Ein Bereich, in dem Bienengift besonders vielversprechend ist, ist die Schmerzlinderung. Viele Studien zeigen, dass Bienengift durch die entzündungshemmenden Eigenschaften des Melittins eine positive Wirkung auf chronische Schmerzzustände wie Arthritis oder rheumatoide Arthritis haben kann. Eine der bekanntesten wissenschaftlichen Untersuchungen wurde in Korea durchgeführt, wo eine doppelblinde, randomisierte Studie zeigte, dass Patienten mit rheumatoider Arthritis eine signifikante Verbesserung der Schmerzsymptome und Gelenkbeweglichkeit durch die Verwendung von Bienengiftinjektionen erlebten (Kim et al., 2011). Diese Behandlung wurde als vielversprechend für Patienten ohne ausreichende Wirkung durch herkömmliche Medikamente bewertet. (Quelle: Kim et al. „Effectiveness of Bee Venom in the Treatment of Rheumatoid Arthritis,“ Clinical Rheumatology, 2011)

Auch die Schmerzlinderung bei Nervenschäden durch Apamin ist gut dokumentiert. Studien zeigen, dass Apamin das Nervensystem direkt beeinflussen kann, indem es die Reizübertragung und -Empfindung verändert, was zu einer Reduzierung von neuropathischen Schmerzen führt.
Die entzündungshemmenden Eigenschaften des Bienengifts werden auch bei der Behandlung von Autoimmunerkrankungen und Entzündungsprozessen genutzt. Besonders bemerkenswert ist die Wirkung von Melittin bei der Behandlung von entzündlichen Erkrankungen wie Arthritis, Multiple Sklerose und Lupus erythematodes. Forschungen aus den USA (z. B. die Arbeit von Wang et al., 2007) haben gezeigt, dass Melittin das Wachstum entzündungsfördernder Zellen hemmt und sogar entzündliche Prozesse im Körper nachweislich reduzieren kann. Es wurde auch gezeigt, dass Bienengift das Immunsystem modulieren kann, indem es die Produktion von Zytokinen, den Botenstoffen, die für Entzündungsreaktionen verantwortlich sind, reguliert. (Quelle: Wang et al., „Anti-inflammatory Effects of Bee Venom and Its Components,“ Journal of Inflammation, 2007).

Eine der aufregendsten Entwicklungen der letzten Jahre ist der Einsatz von Bienengift in der Krebstherapie. Verschiedene wissenschaftliche Studien legen nahe, dass Melittin nicht nur als entzündungshemmender Stoff wirkt, sondern auch die Zellmembranen von Krebszellen angreifen und zerstören kann. Eine Studie aus dem Jahr 2016, die in Australien durchgeführt wurde, zeigte, dass Melittin bei der Behandlung von Brustkrebszellen das Tumorwachstum in vitro signifikant hemmte und das Überleben der Krebszellen drastisch verkürzte. Diese Ergebnisse sind vielversprechend, aber auch hier sind weitere Studien erforderlich, um den klinischen Nutzen und die Anwendung von Bienengift in der Krebstherapie genauer zu verstehen. (Quelle: Park et al., „Bee Venom’s Potential Role in Cancer Therapy,“ Journal of Cancer Research, 2016)

Bienengift hat nicht nur in westlichen Ländern, sondern auch in China, Russland und Südkorea eine lange Tradition in der Medizin. In Russland zum Beispiel wurde Bienengift in den 1950er Jahren intensiv erforscht und in klinischen Studien als potenzielles Heilmittel gegen Gelenkbeschwerden, Rheuma und Migräne eingesetzt. Russlands staatliche Forschungsinstitute haben viele Standardisierungen der Bienengiftanwendungen in der Medizin durchgeführt, was zu einer zunehmenden Nutzung in der Volksmedizin und modernen klinischen Praktiken führte. Studien belegen, dass Bienengift dort nicht nur zur Schmerztherapie verwendet wird, sondern auch zur Unterstützung des Immunsystems und zur Förderung der allgemeinen Heilung. (Quelle: Shara et al., „Bee Venom as a Natural Immune System Booster,“ Russian Journal of Medicinal Chemistry, 2015)
In Südkorea hat sich Bienengift als Behandlungsoption für Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Parkinson und Alzheimer etabliert. Klinische Studien zeigen vielversprechende Ergebnisse, die auf die neuroprotektive Wirkung von Bienengift hinweisen, da es die entzündungsbedingte Schädigung des Nervensystems reduziert und die Bildung von Tau-Proteinen in Gehirnzellen hemmt. (Quelle: Lee et al., „Neuroprotective Effects of Bee Venom,“ Korean Journal of Neurology, 2018)
Praktische Anwendung und Sicherheit
Die Anwendung von Bienengift in der Medizin erfolgt häufig durch Bienengift-Injektionen, Akupunktur mit Bienengift oder die Verwendung von Bienengift-Cremes. Eine weitere Methode ist die sogenannte Stichtherapie, bei der Patienten direkt von Bienen gestochen werden, um die Vorteile des Gifts in ihrer vollen Stärke zu nutzen. Es ist wichtig, diese Therapie nur unter professioneller Anleitung durchzuführen, da Bienengift starke allergische Reaktionen hervorrufen kann. Menschen mit Bienenallergien oder anderen bekannten Reaktionen auf Bienengift sollten die Anwendung auf jeden Fall vermeiden.
Forschung und klinische Studien weltweit belegen zunehmend das medizinische Potenzial von Bienengift, aber es bleibt ein kontroverses Thema. Es gibt noch viele unbeantwortete Fragen zu Dosierung, langfristigen Effekten und potenziellen Risiken, sodass Bienengift nur unter ärztlicher Aufsicht und nach sorgfältiger Abwägung seiner Vorteile und Risiken eingesetzt werden sollte.
„Äthiopiens uralte Bienenkultur“

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela
In Äthiopien besitzen Bienen eine außergewöhnliche Bedeutung, die weit über die Honigproduktion hinausgeht. Die Imkerei ist dort eng mit Spiritualität, Geschichte und Heilkunst verbunden und prägt bis heute das kulturelle Selbstverständnis vieler Regionen. Schon seit mehreren Jahrtausenden wird Honig in Äthiopien genutzt, was Berichte der äthiopischen Landwirtschaftsbehörde bestätigen. Dieses alte Handwerk hat sich in vielen ländlichen Gebieten in nahezu unveränderter Form erhalten. Traditionelle Bienenstöcke werden hoch in Bäumen aufgehängt, oft aus natürlichen Materialien gefertigt und mithilfe von Kräutern und Rauch vorbereitet, um Bienenschwärme anzuziehen. Ethnobiologische Untersuchungen in der Region Borena Sayint zeigen, wie tief verwurzelt diese Praxis ist und wie viel Wissen über Pflanzen, Jahreszeiten und das Verhalten der einheimischen Bienenart Apis mellifera simensis an die nächste Generation weitergegeben wird.

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela
Eine besonders faszinierende Verbindung zwischen Bienen und Glauben findet sich in der Geschichte um König Lalibela. Der Legende nach wurde er in seiner Kindheit von einem Schwarm Bienen umgeben, was seine Mutter als göttliches Zeichen deutete. Diese Überlieferung hat sich stark in der Region verankert und verleiht der Imkerei in Lalibela eine spirituelle Tiefe, die bis heute spürbar ist. Die berühmten Felskirchen dieser Gegend sind nicht nur architektonische Wunder, sondern auch Orte, an denen Bienen seit Jahrhunderten ihre Nester bauen. In einigen Kirchen produzieren sie einen Honig, der als Mar bekannt ist. Dieser Honig wird in Ritualen der äthiopisch orthodoxen Kirche verwendet und gilt traditionell als heilig sowie als unterstützendes Mittel bei der Linderung verschiedener Beschwerden. Berichte aus Gemeinden rund um Lalibela erzählen, dass dieser besondere Honig nur im Kontext religiöser Zeremonien eingesetzt wird und nicht für den Verkauf bestimmt ist. Diese Erzählungen gehören zur spirituellen Tradition der Region und unterstreichen die große Wertschätzung des Honigs.

Bildquelle: www.droomplekken.nl/ethiopie/lalibela
Neben dem religiösen Hintergrund spielt in Äthiopien auch die traditionelle Verwendung von Bienenwachs eine wichtige Rolle. Wachs wird seit Jahrhunderten für die Herstellung von Andachtskerzen genutzt, die bei Festen, Prozessionen und Gebeten zum Einsatz kommen. Gleichzeitig ist Wachs vielerorts ein wichtiges Handelsgut, das eng mit der klassischen Baumimkerei verbunden ist. Moderne Imkereiprojekte knüpfen an diese tiefen Wurzeln an. Organisationen wie die Ethiopian Apiculture Development Association fördern nachhaltige Imkereimethoden, unterstützen die Aufforstung und bieten Schulungen an, um die Honigqualität zu verbessern. Besonders bemerkenswert sind die Projekte rund um Lalibela, in denen Bienenhaltung mit Wiederaufforstung kombiniert wird. Neue Bäume schaffen Nahrung für die Bienen und verbessern gleichzeitig den Schutz der Landschaft. Dadurch entsteht ein ökologischer Kreislauf, von dem sowohl Natur als auch die ländlichen Gemeinden profitieren. Ein weiter wachsender Teil der Imkerei wird heute von Frauen getragen, da moderne Bienenstöcke leichter zugänglich sind als die traditionellen, die in Baumwipfeln hängen. So verbindet die äthiopische Imkerei wirtschaftliche Chancen mit kultureller Identität.

Für mich persönlich hat dieses Thema eine besondere Tiefe bekommen, als ein Freund mir Honig direkt aus Äthiopiens Region schenkte. Ich durfte diesen Honig sogar zweimal probieren, darunter auch echten Wildbienhonig aus der Region, und habe einen kleinen Vorrat davon bei mir zuhause. Sein Geschmack ist beeindruckend intensiv und vielschichtig und erinnert in seiner Stärke teilweise an meinen eigenen Waldhonig, hat jedoch eine ganz eigene Aromatik und einen besonderen Geruch, der sich deutlich von europäischen Honigen unterscheidet. Dieses Geschenk hat mich dankbar gemacht und mir gezeigt, wie viel Geschichte, Landschaft und Kultur in einem einzigen Löffel Honig stecken können. So bewegt sich die äthiopische Imkerei in einem spannenden Feld zwischen uralten Überlieferungen, spiritueller Bedeutung, modernen Projekten und persönlichen Erlebnissen. Sie zeigt, wie eng ein Volk mit seinen Bienen verbunden sein kann und wie ein jahrtausendealtes Wissen bis heute lebendig bleibt.
Videoquelle: Äthiopien: Summende Schutzengel | Die Bienenflüsterer Reupload | ARTE Family
„Summen statt schießen“
Wo Imkerei zu Naturschutz wird

Bienen und Elefanten passen besser zusammen, als man denkt. In vielen Regionen Ostafrikas hat sich gezeigt, dass man mit Bienenstöcken Felder deutlich besser vor Elefanten schützen kann als mit teuren Elektrozäunen. Der Hintergrund ist einfach. Elefanten haben im Lauf ihres Lebens gelernt, dass ein ganzer Bienenschwarm sehr schmerzhaft an Augen, Maul und vor allem am empfindlichen Rüssel stechen kann. Sie meiden Bienen deshalb aus Erfahrung, nicht aus menschlicher Angst.
Die britische Zoologin Lucy King, die für Save the Elephants arbeitet und mit der Universität Oxford forscht, hat diese Beobachtung von kenianischen Bäuerinnen aufgegriffen. Sie spielte Elefanten Aufnahmen von aufgescheuchten afrikanischen Honigbienen vor. Die Tiere gingen sofort auf Abstand und gaben dabei einen besonderen tieffrequenten Warnruf ab, den auch andere Elefanten verstehen. 2010 wurde dieser Bienengefahr Ruf erstmals wissenschaftlich beschrieben. Damit war klar, dass man Bienen gezielt als Abschreckung nutzen kann.

Bildquelle: www.engineeringforchange.org
Daraus entstanden die sogenannten Bienen Zäune. Um ein Feld werden Pfosten gestellt, daran hängt ein Draht, an diesem Draht hängen in Abständen Bienenkästen. Berührt ein Elefant den Draht, schaukeln die Kästen, die Bienen fliegen aus, das Tier weicht zurück und die Herde bleibt fern. In Auswertungen, die unter anderem mit Oxford durchgeführt wurden, konnten so etwa 80 bis 85 Prozent der Elefanteneinfälle verhindert werden. Gleichzeitig bestäuben die Bienen die Feldfrüchte und liefern Honig, der verkauft werden kann. Häufig kümmern sich Frauen aus den Dörfern um die Kästen, sodass eine zusätzliche Einnahmequelle entsteht. Genau das macht die Methode so attraktiv. Sie schützt nicht nur, sie bringt auch etwas ein.
Videoquelle: Südafrika: Bienen gegen Elefanten | DW Deutsch
Ein weiterer wichtiger Schritt war, dass 2018 in Sri Lanka gezeigt wurde, dass auch asiatische Elefanten auf Bienengeräusche ähnlich reagieren. Damit ist das System nicht nur für Afrika geeignet, sondern auch für Länder wie Indien, Sri Lanka oder Nepal, in denen ebenfalls Felder von Elefanten zerstört werden.
Ganz perfekt ist die Methode nicht. Sie wirkt nur, wenn die Kästen tatsächlich von Bienen besiedelt sind. In Trockenzeiten oder bei mangelndem Nektar lässt der Schutz nach. Deshalb müssen die Zäune gepflegt und die Völker betreut werden. Langzeitdaten aus Kenia zeigen genau das. Wo Imkerei und Landwirtschaft zusammenarbeiten, bleibt der Schutz stabil, wo die Kästen leer werden, kommen die Elefanten zurück.
Trotzdem gilt das Konzept heute als eines der cleversten Beispiele für Naturschutz mit einfachen Mitteln. Es trennt die Dörfer nicht hart von der Natur ab wie ein Elektrozaun, sondern bindet sie ein. Menschen bekommen Honig, Felder werden bestäubt, Elefanten bleiben auf Abstand. Und alles funktioniert, weil man eine Fähigkeit der Tiere nutzt, die sie längst haben.
„PROPOLIS“
Wenn Bäume Wunden schließen und Bienen daraus Heilkunst machen

Propolis ist ein Stoff, der gleichzeitig nach Wald riecht und nach Labor klingt. Es beginnt alles beim Baum. Wenn ein Baum verletzt wird, zum Beispiel wenn ein Ast abbricht oder die Rinde aufplatzt, dann verschließt der Baum diese Wunde mit Harz. Dieses Harz ist klebrig, reich an aromatischen Pflanzenstoffen und wirkt wie ein natürlicher Schutzverband. Es hält Pilze, Bakterien und Insekten fern, damit die Wunde nicht verfault und sich keine Fäulnis ausbreiten kann. Genau diese Fähigkeit, sich selbst zu schützen, ist seit langer Zeit Gegenstand medizinischer Beobachtung. In Finnland begann man bereits in den neunziger Jahren systematisch zu untersuchen, wie Salben aus dem Harz der Fichte, also Harzsalben aus Picea abies, bei schlecht heilenden Wunden helfen. In klinischen Untersuchungen aus den Jahren um zweitausendacht bis zweitausenddreizehn zeigte sich, dass solche Fichtenharzsalben selbst bei chronischen Druckgeschwüren, Operationswunden oder diabetischen Fußwunden helfen konnten. In einer multizentrischen klinischen Studie mit Patientinnen und Patienten, die lang bestehende Druckgeschwüre hatten, heilten unter Fichtenharzsalbe deutlich mehr Wunden vollständig aus als in der Vergleichsgruppe, die eine herkömmliche Wundauflage bekam. Dieser Effekt zeigte sich sogar bei Wunden, die mit sehr hartnäckigen Keimen wie MRSA infiziert waren, also Bakterien, die gegenüber vielen Antibiotika widerstandsfähig sind. Forschende wie Arno Sipponen aus Finnland beschrieben in Publikationen aus den Jahren zweitausendacht bis zweitausenddreizehn, dass traditionelle Fichtenharzsalbe messbar antibakteriell wirkt, gegen Bakterien und Pilze aktiv ist und bei chronischen Wunden die Heilung unterstützt, und zwar nicht nur in Einzelfällen, sondern in strukturierten klinischen Beobachtungen und auch in einer prospektiven randomisierten Vergleichsstudie. Diese Harzsalben wurden sogar in Tiermodellen, zum Beispiel bei Wundheilung nach Eingriffen bei Ferkeln, systematisch getestet, wobei die Harzsalbe schneller für saubere, geschlossene Wundränder sorgte als Standardbehandlungen. Die Botschaft aus dieser Linie der Forschung war klar. Baumharz ist keine bloße Waldgeschichte, es kann tatsächlich Wundheilung unterstützen und Infektionen eindämmen, und das wurde wissenschaftlich begleitet, nicht nur in der Volksheilkunde.

An dieser Stelle tritt die Honigbiene auf. Die Biene sieht den Baum nicht nur als Trachtspender, sondern als Apotheke. Die Sammelbienen holen Harz von verletzten Stellen und Knospen verschiedener Bäume, in Mitteleuropa zum Beispiel von Pappel, Birke, Fichte, Kiefer, Weide, Ulme oder Kastanie. Dieses Rohharz verarbeiten die Bienen weiter. Sie mischen es mit eigenem Wachs, Speichelsekreten und kleinsten Anteilen von Pollen. Aus diesem Gemisch entsteht Propolis. Man könnte sagen, Propolis ist Baummedizin, die von den Bienen weiterentwickelt wurde. Chemisch ist Propolis ein sehr komplexes Naturgemisch aus mehreren Hundert Einzelsubstanzen. Dazu gehören Flavonoide wie Pinocembrin, Galangin oder Chrysin, dazu Phenolsäuren wie Kaffeesäure und Ferulasäure und deren Ester, außerdem aromatische Säuren, Terpene, Wachse, ätherische Öle und Mineralstoffe. Die genaue Zusammensetzung schwankt stark je nach Region, Jahreszeit und Pflanze. Eine Propolis aus einem Pappelgebiet in Europa sieht chemisch anders aus als eine Propolis aus dem tropischen Brasilien oder aus Japan. Moderne Analysen, unter anderem mit Hochleistungsflüssigkeitschromatografie gekoppelt an Massenspektrometrie, zeigen diese riesige Vielfalt sehr deutlich. Diese Vielfalt ist faszinierend, aber sie macht Propolis später regulatorisch kompliziert, dazu kommen wir gleich.

Im Bienenvolk selbst ist Propolis überlebenswichtig. Ein Bienenstock ist ein dicht besiedelter Lebensraum mit konstant warmer Temperatur und hoher Luftfeuchtigkeit. Eigentlich wären das ideale Bedingungen für Keime aller Art. Die Bienen nutzen Propolis, um jede Ritze abzudichten und Oberflächen zu überziehen. Brutwaben, Spalten, Eingänge, alles wird ganz dünn mit Propolis ausgekleidet. So entsteht eine Art antiseptische Innenhaut des Stocks. Das senkt die Keimlast und stabilisiert das Immunsystem des gesamten Volkes. Besonders eindrucksvoll ist das Verhalten der Bienen, wenn ein Eindringling im Stock stirbt, zum Beispiel eine Maus. Eine Maus ist körperlich zu groß, um hinausgetragen zu werden. Würde sie einfach im Stock verwesen, wäre das für das Volk eine tödliche Seuchenquelle. Stattdessen überziehen die Bienen den Tierkörper vollständig mit Propolis. Sie versiegeln ihn. Dadurch wird Fäulnis eingekapselt und Erreger werden gebunden. Man kann das als eine Art natürliche Mumifizierung verstehen. Das ist nicht nur ein schöner Naturfilm Moment. Es ist der direkte Beweis dafür, dass Propolis im Bienenstock eine starke antimikrobielle und konservierende Rolle hat. Ähnliche Beobachtungen machen Imkerinnen und Imker auch bei großen Insekten oder bei Bienenkörpern, die nicht sofort entfernt werden können. Das Bienenvolk nutzt Propolis also als aktiven Infektionsschutz und als Hygienewerkstoff.
Diese antimikrobielle Kraft von Propolis hat die Menschheit früh fasziniert. Schon in antiken Quellen aus dem Mittelmeerraum wird Propolis als Mittel gegen Entzündungen, zur Wundpflege und für Beschwerden im Mund und Rachen erwähnt. In mittelalterlichen und frühneuzeitlichen Rezepturen taucht Propolis in Salben und Tinkturen auf, vor allem bei Hautproblemen, vereiterten Wunden und Zahnfleischentzündungen. Besonders intensiv wurde Propolis in Osteuropa und Russland genutzt und weitergegeben. In Russland und später in der Sowjetunion wurde Propolis nicht nur als Hausmittel betrachtet, sondern ernst genommen als medizinisch relevantes Naturprodukt. In den sechziger Jahren und siebziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts wurde Propolis in der Sowjetunion in Form von alkoholischen Propolislösungen offiziell in die medizinische Praxis eingeführt, sowohl in der Humanmedizin als auch in der Veterinärmedizin. Das bedeutet, Propolis war dort nicht nur ein Bienenprodukt aus dem Hofladen, sondern es wurde wie ein Wirkstoff betrachtet, mit Einsatz bei schlecht heilenden Wunden, bei Infektionen im Mund Rachen Bereich und bei entzündlichen Hauterkrankungen. Dabei beschrieb die sowjetische Literatur ausdrücklich antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften sowie die Fähigkeit, den Heilungsverlauf von verletztem Gewebe zu unterstützen. Das war bemerkenswert früh, verglichen mit Westeuropa, wo Propolis lange eher als Randthema galt. Diese frühe offizielle Anerkennung in der Sowjetunion wurde später zur Grundlage der osteuropäischen Apitherapie Tradition, also der Heilkunde mit Bienenprodukten.
In den letzten Jahrzehnten hat sich die Forschung zu Propolis international stark ausgedehnt. Drei große Felder stechen besonders hervor. Erstens der Bereich Infektionen und Atemwege. Zweitens die Zahn und Mundgesundheit. Drittens die Wundheilung.
Beginnen wir mit den Atemwegen. In Italien wurde im Jahr zweitausendzwanzig eine randomisierte doppelblinde placebo kontrollierte klinische Studie mit einem standardisierten Propolis Halsspray durchgeführt. In dieser Studie wurden erwachsene Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit akuten unkomplizierten Infekten der oberen Atemwege untersucht. Die Personen erhielten entweder ein Propolis Spray oder ein Placebo ohne Wirkstoff und wurden über mehrere Tage ärztlich begleitet. Die Auswertung, die im Jahr zweitausendeinundzwanzig veröffentlicht wurde, zeigte, dass in der Propolisgruppe Halsschmerzen, Hustenreiz und allgemeines Krankheitsgefühl schneller abnahmen und die Symptome häufiger innerhalb weniger Tage zurückgingen als in der Placebogruppe. Dabei traten keine schwerwiegenden Nebenwirkungen auf. Diese Studie ist wichtig, weil sie kontrolliert und verblindet war. Das heißt, weder die Teilnehmenden noch die Ärztinnen und Ärzte wussten, wer das echte Spray und wer das Placebo bekommen hat. Dadurch gilt das Ergebnis als belastbarer Hinweis darauf, dass standardisierte Propolisextrakte tatsächlich Beschwerden im Hals Rachen Bereich bei leichten Infekten lindern können. Diese Studie wurde unter anderem von Esposito und Kolleginnen in Italien ausgewertet und zwei tausend zwanzig bis zwei tausend einundzwanzig publiziert.
Auf diese Richtung bauten weitere Untersuchungen auf, unter anderem in Ländern wie Polen und Brasilien, aber auch in Osteuropa und Asien. Analysen aus den Jahren zwei tausend dreiundzwanzig und zwei tausendvierundzwanzig fassen verschiedene klinische Arbeiten zusammen, in denen Propolis bei Infekten der oberen Atemwege eingesetzt wurde, auch bei Kindern. Dabei wurde beobachtet, dass standardisierte Propolispräparate bei viralen und bakteriellen Entzündungen im Hals Rachen Raum dazu beitragen können, dass die Beschwerden schneller abklingen. Diese Auswertungen betonen, dass Propolis offenbar entzündungsregulierend und antimikrobiell wirkt und dass es in manchen Fällen als Ergänzung zur üblichen Versorgung dienen kann. Die Autoren betonen aber auch, dass Propolis keine ärztlich notwendige Behandlung ersetzt und besonders bei ernsteren Erkrankungen der Atemwege nicht allein stehen darf.

Eine besondere Beachtung hat Propolis auch im Zusammenhang mit Covid neunzehn gefunden. In Brasilien wurde in den Jahren zwei tausend einundzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig eine Reihe klinischer Studien mit einem standardisierten Extrakt aus brasilianischer grüner Propolis durchgeführt, der unter der Bezeichnung EPP AF geführt wird. In einer randomisierten kontrollierten klinischen Studie aus dem Jahr zwei tausend einundzwanzig wurden hospitalisierte erwachsene Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn zusätzlich zur Standardtherapie entweder mit diesem standardisierten Propolis Extrakt in definierter Dosierung behandelt oder bekamen nur die Standardtherapie ohne Propolis. Die Studie zeigte, dass die Patientinnen und Patienten, die Propolis zusätzlich erhielten, im Mittel kürzer im Krankenhaus blieben. Außerdem traten in der hochdosierten Propolisgruppe weniger Komplikationen wie akute Nierenschädigungen auf. Die Verträglichkeit wurde als gut beschrieben. Es gab keine auffälligen schweren Nebenwirkungen, die eindeutig auf Propolis zurückzuführen waren. Diese Ergebnisse wurden von Silveira und Kolleginnen im Jahr zwei tausend einundzwanzig veröffentlicht.
In einer weiteren streng durchgeführten Studie aus Brasilien, publiziert im Jahr zwei tausenddreiundzwanzig, diesmal doppelblind und placebo kontrolliert, also noch strenger im Studiendesign, wurde untersucht, wie sich derselbe standardisierte Propolis Extrakt bei hospitalisierten Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn auswirkt. Dabei wurden die Patientinnen und Patienten zufällig auf Propolis plus Standardtherapie oder Placebo plus Standardtherapie verteilt. Diese Auswertung zeigte, dass der Propolis Extrakt vor allem die Rate von zusätzlichen bakteriellen Folgeinfektionen im Krankenhaus senken konnte. Solche zusätzlichen Infektionen gelten bei schweren Virusinfektionen der Atemwege als ein großes Risiko, weil sie den Verlauf stark verschlechtern und die Behandlung komplexer machen. In dieser Studie wurde also der mögliche Nutzen von Propolis als Ergänzung zur üblichen Behandlung nicht nur im Sinn von Symptomlinderung gesehen, sondern auch im Sinn einer Stabilisierung des klinischen Verlaufs bei schweren Infekten. Gleichzeitig wurde betont, dass Propolis trotz der positiven Beobachtungen die Standardbehandlung nicht ersetzt, sondern im besten Fall begleitet. Diese Ergebnisse wurden zwei tausenddreiundzwanzig veröffentlicht, ebenfalls von Silveira und Kolleginnen.
Das zweite große Feld ist die Mund und Zahngesundheit. In der Zahnmedizin gilt chronische Zahnfleischentzündung als ein Dauerproblem. Es gibt wiederkehrende Plaquebildung, entzündetes Zahnfleisch, kleine Blutungen beim Zähneputzen und schmerzhafte Stellen am Zahnfleischrand. In klinischen Untersuchungen aus den letzten Jahren wurde Propolis in Form von Mundspüllösungen oder Sprays eingesetzt. Dabei zeigte sich, dass Propolis die Menge an Zahnbelag reduzieren und das gereizte Zahnfleisch beruhigen kann. Kontrollierte Studien berichten, dass Propolis die Zahnfleischentzündung mindern konnte, ohne schwere Nebenwirkungen zu verursachen. Diese zahnmedizinischen Studien stammen vor allem aus Italien und Polen und wurden um die Jahre zwei tausendzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig publiziert. Die Forschenden erklären die Wirkung damit, dass Propolis Bakterienwachstum hemmt, Entzündungssignale im Gewebe herunterfährt und das Zahnfleisch in Richtung Heilung und Beruhigung verschiebt. Propolis wird deshalb in der Zahn und Mundpflege inzwischen als interessante natürliche Ergänzung diskutiert, vor allem in Phasen gereizter Schleimhäute.

Das dritte Feld ist die Wundheilung. Hier schließt sich der Kreis zurück zum Baumharz. Bereits in den frühen zweitausender Jahren und verstärkt ab zwei tausendacht haben Ärztinnen und Ärzte in Finnland und später auch in anderen europäischen Ländern dokumentiert, dass Salben auf Basis von Fichtenharz bei langwierigen, entzündeten und sogar mit multiresistenten Keimen belasteten Wunden sehr gute Heilungsverläufe unterstützen konnten. In einer randomisierten multizentrischen Studie, die in Finnland zwischen zwei tausendfünf und zwei tausendsieben durchgeführt und zwei tausendacht veröffentlicht wurde, heilten schwergradige Druckgeschwüre unter Fichtenharzsalbe deutlich häufiger vollständig aus als unter einer damals üblichen modernen Wundauflage. In einer weiteren klinischen Studie wurden komplizierte Operationswunden untersucht, die nur schlecht schließen wollten. Auch hier zeigte sich, dass Fichtenharzsalbe die Heilung beschleunigen und die Belastung mit Keimen reduzieren konnte. Diese Arbeiten waren deshalb so bedeutsam, weil sie zeigten, dass ein traditioneller Harzverband aus dem Wald in einem modernen Krankenhaussetting bestehen kann. Die Forschenden beobachteten, dass Fichtenharz sowohl gegen Bakterien als auch gegen Pilze wirkt und gleichzeitig die Bildung neuen Gewebes begünstigt. Diese Forschungsrichtung hat sich seitdem fortgesetzt und ist heute noch aktiv, in Finnland, Skandinavien und inzwischen auch in anderen Ländern Europas.
Diese Beobachtungen zur Wundheilung passen sehr gut zu dem, was man über Propolis aus dem Bienenstock weiß. Propolis wirkt nachweislich antibakteriell, antiviral und pilzhemmend. In vielen Labormodellen hemmt Propolis das Wachstum von Staphylococcus aureus, inklusive Stämmen, die gegen gängige Antibiotika unempfindlich sind. Es greift Bakterien nicht nur direkt an, sondern stört auch deren Fähigkeit, Biofilme zu bilden. Biofilme sind schleimige Schutzschichten, die Bakterien bilden, um sich gemeinsam auf Oberflächen festzusetzen. Solche Biofilme machen Infektionen oft schwer behandelbar, zum Beispiel bei chronischen Wunden oder auf Schleimhäuten. Propolis kann außerdem die Kommunikation zwischen Bakterien stören. Das nennt man manchmal Quorum Sensing. Wenn Bakterien schlechter miteinander kommunizieren können, können sie sich schlechter koordinieren und ihre Angriffsstrategien verlieren an Wirksamkeit. Dazu kommen antivirale und antimykotische Effekte, die in Laborstudien unter anderem gegen Candida Arten und verschiedene Viren gezeigt wurden. All das erklärt, warum Propolis für die Bienen hygienischer Schutzstoff Nummer eins ist und warum Menschen es seit Jahrhunderten auf geschädigte Haut oder gereizte Schleimhäute geben. Diese Effekte werden inzwischen weltweit beschrieben, etwa in Untersuchungen aus Iran, Brasilien, Vietnam, Japan und Griechenland, wo der jeweilige regionale Propolis Typ ganz unterschiedliche Leitstoffe enthält, aber in Labortests wieder und wieder antimikrobielle Aktivität zeigt.
Neben der direkten Wirkung gegen Keime interessiert die Forschung heute besonders die entzündungsregulierende Wirkung von Propolis. Entzündung ist zunächst nichts Schlechtes. Sie ist die Sprache, mit der unser Immunsystem auf Verletzung oder Krankheit reagiert. Aber zu viel Entzündung oder dauerhaft anhaltende Entzündung schadet Gewebe und verzögert Heilung. In Laboruntersuchungen und Tierversuchen hat man gesehen, dass Propolis bestimmte Botenstoffe der Entzündung dämpfen kann. Dazu gehören Signalstoffe wie Interleukin eins beta oder Tumor Nekrose Faktor alpha, die für starke Entzündungsreaktionen verantwortlich sind. Wenn diese Signale gezielt etwas heruntergefahren werden, kann Gewebe sich beruhigen und Heilung besser anlaufen. Genau diese Eigenschaft könnte erklären, warum Propolis in Studien aus den Jahren zwei tausend einundzwanzig bis zwei tausenddreiundzwanzig bei Patientinnen und Patienten mit Covid neunzehn nicht nur die Keimbelastung beeinflusst hat, sondern auch Komplikationen wie überschießende Entzündungsreaktionen im Körper, zum Beispiel am Lungen und Nierenapparat. Diese entzündungsmodulierenden Eigenschaften werden derzeit auch in ganz anderen Bereichen untersucht, etwa in der Dermatologie, in der Wundversorgung nach Operationen und in der Zahnmedizin bei gereiztem Zahnfleisch.

So weit klingt Propolis fast wie ein perfekter Naturstoff für die Hausapotheke. Und tatsächlich wird Propolis in vielen Ländern als Tropfen, Tinktur, Spray, Salbe, Lutschpastille oder Mundspülung frei verkauft. Trotzdem ist die rechtliche Lage nicht überall gleich, und gerade in Deutschland ist die Einstufung von Propolis heikel. Der Grund dafür ist nicht nur Bürokratie, sondern Wissenschaft.
In Deutschland gilt für alles, was als Arzneimittel verkauft werden soll, ein strenges Zulassungsverfahren. Ein Präparat muss eindeutig zusammengesetzt, reproduzierbar herstellbar und seine Wirkung muss durch aussagekräftige Daten belegt sein. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, also die zuständige Behörde, verlangt unter anderem den Nachweis von Wirksamkeit, Sicherheit und gleichbleibender Qualität. Das bedeutet unter anderem, dass jede Charge eines Arzneimittels wirklich praktisch identisch sein muss mit der nächsten Charge, damit Ärztinnen und Ärzte genau wissen, was sie verordnen.
Genau das ist bei Propolis schwierig. Propolis ist kein einzelner Wirkstoff, sondern ein Naturverbundstoff aus Hunderten Komponenten, und diese Komponenten hängen vom Standort, von den besuchten Bäumen, von der Jahreszeit und damit letztlich sogar vom Wetter ab. Messungen aus Deutschland und anderen Ländern zeigen, dass Propolis aus zwei aufeinander folgenden Jahren vom selben Standplatz sich chemisch spürbar unterscheiden kann, weil die Bienen je nach Blüte und Baumangebot andere Harze eintragen. Das heißt, Propolis hat nicht eine feste Zusammensetzung, sondern eine Bandbreite. Behörden sehen hier ein Problem. Ein klassisches Arzneimittel muss nachweisen, dass jede Packung gleich ist. Bei Propolis schwankt der Gehalt an Flavonoiden, Phenolsäuren, Terpenen und anderen aktiven Bestandteilen von Natur aus. Deshalb ist eine einheitliche Zulassung als Humanarzneimittel in Deutschland sehr schwer. Verbraucherzentralen und Landesbehörden verweisen außerdem darauf, dass Propolis ein allergenes Potenzial besitzt. Menschen, die stark auf Bienenprodukte reagieren oder auf Baumharze sensibel sind, können Hautreizungen bekommen oder allergische Reaktionen entwickeln. Darum dürfen Imkerinnen und Imker nach deutschem Recht in der Regel kein selbst gemischtes Propolis Präparat als Arzneimittel verkaufen. Sie dürfen meist nur Rohpropolis anbieten. Fertige Propolis Produkte, die als Arzneimittel gelten wollen, müssen den Weg der regulären Zulassung gehen. Das ist teuer und aufwendig und bedeutet, dass man eine gleichbleibende Rezeptur nachweisen muss. Genau daran scheitern viele kleinen Anbieter. Diese Einschätzung ist in Deutschland zum Beispiel durch Bewertungen der Verbraucherzentrale aus dem Jahr zweitausendfünfundzwanzig und durch Fachinformationen aus den Landesbehörden für Lebensmittelüberwachung beschrieben worden. Dort wird betont, dass Propolis rechtlich oft als Nahrungsergänzung vermarktet wird, weil die Schwelle zur echten Arzneimittelzulassung sehr hoch liegt.

Propolis ist ein Naturstoff mit einer langen Kulturgeschichte, einer sehr klaren biologischen Aufgabe im Bienenstock und inzwischen einer beachtlichen Zahl moderner Studien aus vielen Ländern. In Finnland wurden Harzsalben, die gewissermaßen die Baumseite dieser Geschichte verkörpern, bereits vor rund zwei Jahrzehnten klinisch getestet und zeigten bei schwierigen chronischen Wunden beeindruckende Heilungsverläufe, auch bei Keimen, die sonst nur schwer zu kontrollieren sind. In Italien wurden ab zwei tausendzwanzig placebo kontrollierte doppelblinde Studien mit Propolis Halssprays durchgeführt und beschrieben, dass Halsschmerzen und andere Beschwerden der oberen Atemwege schneller nachlassen können. In Brasilien wurden zwei tausend einundzwanzig und zwei tausenddreiundzwanzig randomisierte klinische Studien mit standardisierter grüner Propolis bei stationären Covid Patientinnen und Patienten veröffentlicht, in denen unter anderem kürzere Klinikaufenthalte und weniger zusätzliche Krankenhausinfektionen beobachtet wurden. Osteuropa wiederum hat Propolis schon seit den sechziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts als therapeutisch wertvoll betrachtet und in die praktische Medizin eingebunden, während man im Westen erst viel später begonnen hat, Propolis analytisch zu standardisieren, also chemisch genau zu beschreiben und klinisch sauber zu prüfen.
Das Bild, das sich daraus ergibt, ist fast poetisch. Ein Baum schützt seine Wunde mit Harz. Die Biene holt sich dieses Harz, veredelt es, macht daraus eine Substanz, die das ganze Bienenvolk vor Krankheitserregern schützt, den Stock abdichtet und sogar tote Eindringlinge konserviert, damit keine Fäulnis entsteht. Der Mensch beobachtet dieses Verhalten, lernt davon und versucht, diesen Stoff für sich nutzbar zu machen. Er prüft ihn im Labor, gibt ihn Patientinnen und Patienten und beschreibt ihn wissenschaftlich, von Finnland über Italien bis Brasilien. Gleichzeitig ringt die moderne Arzneimittelregulierung mit genau diesem Stoff, weil er lebendig ist und nie genau gleich. Propolis ist damit ein seltenes Beispiel dafür, dass Natur, Tier und Medizin direkt ineinandergreifen. Es ist ein uralter Werkstoff der Bienenhygiene und gleichzeitig ein moderner Forschungsgegenstand in der Klinik und im Prüflabor. Und auch wenn die Bürokratie manchmal bremst, bleibt dahinter eine einfache Tatsache stehen. Die Biene hat aus Baumharz ein pharmazeutisch hochinteressantes Schutzsystem gebaut, lange bevor der Mensch überhaupt wusste, was ein Bakterium ist.
Quellen:
- Silveira, M. A. D., et al. (2023). „Standardized Brazilian Green Propolis Extract (EPP-AF®) in Hospitalized Adult Patients with COVID-19.“ Scientific Reports, 13(1), 1-9. Link zur Studie
- Esposito, C., et al. (2021). „A Standardized Polyphenol Mixture Extracted from Poplar Type Propolis for Remission of Symptoms of Uncomplicated Upper Respiratory Tract Infection.“ Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.
- Halboub, E., et al. (2020). „Efficacy of Propolis-Based Mouthwashes on Dental Plaque and Gingival Inflammation.“ Clinical and Experimental Dental Research.
- Ożarowski, M., et al. (2023). „The Effects of Propolis on Viral Respiratory Diseases.“ Molecules.
- Zulhendri, F., et al. (2022). „Propolis as Primary or Adjunctive Therapy in Respiratory Tract Related Diseases.“ Médecine et Maladies Infectieuses.

„Im Schatten des Glyphosats – Wenn das Gift die Stille bringt!“
Bienen als Frühwarnsystem für ein krankes Ökosystem
Ein Gespräch mit Thomas Radetzki über Glyphosat, Honig und die Verantwortung der Imker
Vor einigen Wochen führte ich ein langes Telefonat mit Thomas Radetzki, Imkermeister, Umweltaktivist, Gründer der Aurelia Stiftung und einer der profiliertesten Stimmen für den Schutz der Bienen im deutschsprachigen Raum.
Am 12. Februar 2011 erhielt Thomas Radetzki als geschäftsführender Vorstand von Mellifera e. V. den Apisticus-Ehrenpreis für besondere Verdienste in der Imkerei und Bienenkunde.
Ende Oktober 2013 wurden Thomas Radetzki und Achim Willand durch den Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbund der Goldene Stachel verliehen.
Förderpreis Ökologischer Landbau (2013) für die Lehr- und Versuchsimkerei Fischermühle (Mellifera e. V.).
Als Imker bewegt mich seine Arbeit besonders, denn Herr Radetzki hat nicht nur wissenschaftliche, sondern auch seelische Tiefe in seiner Haltung. Er spricht von den Bienen als Lehrmeisterinnen, als Wesen, die uns zeigen, wie Kooperation und Balance funktionieren.
In unserem Gespräch ging es um vieles: um Landwirtschaft, Biodiversität, unsere Gesundheit, und um Glyphosat. Ein Thema, welche von uns oft unterschätzt wird, obwohl es uns alle betrifft.

„Der stille Killer“
Glyphosat wirkt, indem es ein Enzym blockiert, das für den Aufbau aromatischer Aminosäuren in Pflanzen notwendig ist.
Doch dieses Enzym kommt nicht nur in Pflanzen vor, sondern auch in vielen Bodenbakterien und Pilzen. Damit stört Glyphosat die mikrobielle Balance, also das „Immunsystem“ des Bodens. Wenn Böden ihre Mikroflora verlieren, verliert auch die Pflanze an Vitalität.
Die Folge: Nektar- und Pollenqualität verändern sich, und die Bienen schwächen sich langfristig selbst und sterben dabei.
Mehrere wissenschaftliche Studien zeigen, dass Glyphosat nicht nur Pflanzen, sondern auch menschliche Zellen beeinträchtigen kann.
Eine Auswertung der International Agency for Research on Cancer (IARC, WHO, 2015) stufte Glyphosat als „wahrscheinlich krebserregend beim Menschen“ ein.
Andere Forschungsarbeiten, etwa von Antoniou et al. (Environmental Sciences Europe, 2019), weisen auf hormonelle Störungen, DNA-Schäden und negative Effekte auf die Darmflora hin.
Besonders besorgniserregend: Rückstände wurden bereits im Urin, in Muttermilch und in Monokultur Honig wie z.B. Rapshonig nachgewiesen.
Das zeigt, dass Glyphosat längst kein reines Landwirtschaftsproblem mehr ist, sondern Teil unseres Alltags.
Glyphosat ist mehr als nur ein Imker und Agrarthema
Honig ist das Gedächtnis einer Landschaft. Jede Wabe erzählt von den Blüten, den Böden, der Luft und vom Wetter, und leider manchmal auch von den Rückständen menschlichen Handelns. Glyphosat wird oft nur mit Landwirtschaft in Verbindung gebracht. Doch in Wahrheit ist der Stoff längst Teil eines größeren Kreislaufs, der weit in unseren Alltag hineinreicht.
Aktuelle Forschungen (u. a. Environmental Science & Pollution Research, 2023 und ScienceDirect 2024) zeigen, dass in vielen Wasch- und Spülmitteln sogenannte Phosphonate oder aminomethylhaltige Verbindungen enthalten sind.
Diese Stoffe können in Kläranlagen oder beim chemischen Zerfall, unter bestimmten Bedingungen, zu Glyphosat oder ähnlichen Verbindungen (z. B. AMPA) umgewandelt werden.
Das bedeutet: Selbst dort, wo keine Landwirtschaft betrieben wird, kann Glyphosat indirekt entstehen, in Städten, in Haushalten, in Klärschlämmen.
Ein Teil dieser Stoffe gelangt über das Abwasser in Flüsse und schließlich in den Boden zurück. Damit ist Glyphosat nicht nur ein Problem der Äcker, sondern ein Problem der Zivilisation.
Ein oft unterschätztes Risiko ist der illegale Handel mit gefälschten oder nicht zugelassenen Pflanzenschutzmitteln. In mehreren EU-Ländern wurden in den vergangenen Jahren größere Mengen nachgeahmter oder verbotener Produkte sichergestellt, unter anderem bei Einsätzen gegen den Schwarzmarkt. Diese Produkte stammen teilweise aus Kriminell organisierter Produktion und werden zu deutlich niedrigeren Preisen angeboten als reguläre Präparate. Das macht sie für wirtschaftlich unter Druck stehende Betriebe attraktiv, erhöht aber zugleich die Gefahr, dass unbekannte oder zusätzlich giftige Stoffe auf die Felder und als Lebensmitteln bei Ihnen auf dem Tisch gelangen.

Im Laufe unseres Telefonats kamen wir auch auf ein Thema zu sprechen, das zeigt, wie ernst die Aurelia Stiftung dieses Problem nimmt.
Thomas Radetzki hat gemeinsam mit seinem Team zwei Klagen gegen die EU-Kommission eingereicht, um die Verlängerung und erneute Genehmigung des Wirkstoffs Glyphosat rechtlich überprüfen zu lassen.
Diese Verfahren laufen derzeit vor dem Europäischen Gericht in Luxemburg und könnten richtungsweisend für die gesamte europäische Pestizidpolitik werden.
Die Klagen richten sich gegen die Entscheidungen der EU-Kommission von Dezember 2022 und Dezember 2023, die Glyphosat zunächst um ein Jahr und anschließend um zehn Jahre weiter zugelassen haben.
Radetzki und die Aurelia Stiftung wollen damit ein Musterverfahren schaffen, das zeigt, dass Biodiversitätsschutz und Vorsorgeprinzip keine leeren Worte bleiben dürfen.
Klage gegen Glyphosat – ein Signal für Europa
„Wir klagen gegen Glyphosat – Aurelia Stiftung“

Nur wenige Verbraucher wissen, dass Honig in Deutschland keiner verpflichtenden chemischen Kontrolle unterliegt.
Es gibt keine gesetzliche Vorschrift, nach der Honig regelmäßig auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln, Herbiziden oder anderen Chemikalien untersucht werden muss.
Das gilt auch für Sorten, die aus intensiv bewirtschafteten Monokulturen stammen etwa wie Raps-, oder Sonnenblumenhonig.
Gerade diese Trachtpflanzen werden in der konventionellen Landwirtschaft häufig behandelt und zwar nicht nur mit Unkrautvernichtern wie Glyphosat, sondern auch Fungiziden oder Insektiziden.
Ich verzichte bewusst auf den Transport meiner Bienen zu Raps oder andere Monokulturfeldern!
Raps wird in der konventionellen Landwirtschaft häufig mit Glyphosat behandelt, manchmal kurz vor der Ernte. Damit wird jede Tracht zu einem Spiel mit dem Risiko.
Für mich ist das kein Standort, sondern russisches Roulette mit meinen Bienen, mit dem Honig und letztlich mit unserer Gesundheit.
Bienen als Botschafterinnen
Ein Herzensprojekt von Thomas ist die geplante „Embassy of Bees“, die „Botschaft der Bienen“.
Sie soll eine diplomatische Institution werden, die auf internationaler Ebene für die Rechte der Bestäuber spricht, eine Art „UNO der Bienen“.
Ein visionärer Gedanke, dass Tiere, die uns das Leben ermöglichen, endlich auch eine Stimme in der Politik bekommen. Diese Idee berührt mich als Imker zutiefst, denn die Bienen sind mehr als nur Honiglieferanten. Sie sind Frühwarnsysteme, Lehrmeisterinnen und Mahnerinnen.
Wenn die Bienen verstummen, dann tut es die Natur gleich mit!

Von Glyphosat zu Gleichgewicht – der Blick nach vorn!
Ich sehe meine Arbeit als Imker inzwischen nicht mehr nur als Pflege meiner Bienenvölker, sondern als Beitrag zu einer größeren Bewegung.
Ich will Honig nicht nur schleudern, sondern auch mein Beitrag leisten.
Denn Glyphosat ist letztlich nur ein Symptom. Das eigentliche Thema ist, wie wir mit Chemikalien, Gesundheit, mit Boden, Wasser, Pflanzen, Tieren und uns selbst umgehen.
Thomas Radetzki sagte: „Von den Bienen zu lernen heißt, sich ums Ganze zu kümmern.“
Und genau das möchte ich tun!
Als Imker, der zuhört, dem Boden, den Pflanzen, den Bienen und den Menschen, die verstehen wollen, wie alles zusammenhängt.
Ich möchte mich herzlich bei Thomas Radetzki für das inspirierende und tiefgehende Telefonat bedanken!
Unser Gespräch hat mir gezeigt, wie viel Engagement, Wissen und Herzblut in seiner Arbeit für die Bienen, die Landwirtschaft und unsere gemeinsame Zukunft steckt.
Seine Gedanken über Verantwortung, Boden und Bewusstsein wirken lange nach, und bestärken mich, meinen eigenen Weg als Imker mit noch mehr Achtsamkeit und Entschlossenheit zu gehen!
Mehr über die Arbeit von Thomas Radetzki, Aurelia Stiftung und aktuelle Forschungsprojekte findest du auf:
Thomas Radetzki: https://www.radetzki.com
Aurelia Stiftung: https://www.aurelia-stiftung.de
Das Buch von Thomas Radetzki „Inspiration Biene“ Buchautoren: Thomas Radetzki und Matthias Eckoldt
„Biotechnologie der Antike“
Wie Ägypter Honig und Propolis revolutionär nutzten

Stellen Sie sich vor, Sie öffnen ein Grab, das seit über drei Jahrtausenden versiegelt war, und finden in einer verzierten Vase einen goldene, dickflüssige Substanz, und sie ist immer noch genießbar. Dies ist kein Märchen, sondern die Realität für Archäologen, die auf den honiggefüllten Grabschatz der alten Ägypter stoßen. Doch dieses Wunder der Haltbarkeit ist nur die Spitze eines tiefen und faszinierenden Geheimnisses. Für die Zivilisation am Nil war das Geschenk der Bienen weit mehr als nur Süße; es war der göttliche Ursprung ihrer Kultur selbst. Der Legende nach entstanden die ersten Bienen aus den Tränen des Sonnengottes Ra, als sie auf die Erde fielen. Diese göttlichen Geschöpfe, der „Schweiß der Götter“, begannen sofort, Waben zu bauen und den Göttern zu dienen eine Verbindung, die so fundamental war, dass der Pharao selbst den Titel „Herr der Bienen“ trug und in Tempeln wie dem von Ne-User-Re die ältesten Darstellungen der Imkerei verewigt wurden.
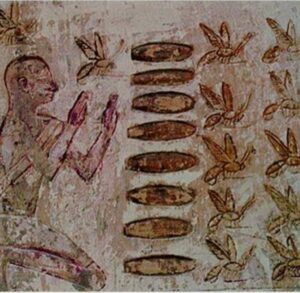
Bildquelle: Imkerei im Alten Ägypten – Wikipedia
Aus diesem mythologischen Ursprung erwuchs eine der fortschrittlichsten und verehrtesten Praktiken des alten Ägyptens die Imkerei. Die Ägypter waren nicht nur passive Sammler, sie waren die ersten Wanderimker der Geschichte. Sie platzierten ihre tonnenförmigen Bienenstöcke aus Ton und Stroh auf Booten und ließen sich den Nil auf und ab treiben, ein sich ständig wandelndes Buffet aus blühenden Pflanzen für ihre Völker. Diese geniale Logistik sicherte nicht nur den Fortbestand der Bienen, sondern auch die Produktion eines Luxusgutes, das die Tafeln der Reichen und Adeligen zierte. Honig war das ultimative Süßungsmittel, die Grundlage für berauschenden Met und die geheime Zutat in unzähligen köstlichen Rezepten.
Doch sein wahrer Wert lag in seiner Macht über Leben und Tod. Schlägt man den berühmten Ebers Papyrus auf, eine umfassende medizinische Enzyklopädie, so stößt man auf über 900 Rezepte, in denen Honig eine zentrale Rolle spielt. Ob zur Behandlung von infizierten Wunden, Verbrennungen oder Augenleiden. Die heilende Kraft des Honigs war den Priesterärzten wohlbekannt. Was sie damals nutzten, bestätigt die moderne Wissenschaft heute. Die einzigartige Kombination aus geringem Wassergehalt, hohem Zuckergehalt und dem natürlichen Enzym, das Wasserstoffperoxid freisetzt, verleiht dem Honig seine stark antibakteriellen und damit unverderblichen Eigenschaften. Studien in Fachzeitschriften wie „The Journal of Wound Care“ belegen, was die Ägypter bereits praktizierten.

Die Bienen hielten ein noch mächtigeres Geheimnis in ihrem Arsenal verborgen: Propolis. Dieses klebrige, harzige Kittharz, mit dem sie ihren Stock abdichten, wurde von den Ägyptern als das „braune Gold“ der Bienen verehrt. Seine bemerkenswerten Eigenschaften machten es zu einem unverzichtbaren Werkzeug für die vielleicht wichtigste kulturelle Praxis Ägyptens die Mumifizierung. Die Einbalsamierer, die wahrscheinlich über ein profundes Wissen der Bienenprodukte verfügten, nutzten Propolis aufgrund seiner stark antibakteriellen und pilzhemmenden Wirkung, um die heiligen Körper der Verstorbenen vor dem Verfall zu bewahren. Auch die Mumifizierung heiliger Tiere wie des Apis-Stiers wäre ohne diesen Schutz kaum denkbar gewesen. Betrachtet man moderne Forschungsübersichten, beispielsweise im „Asian Pacific Journal of Cancer Prevention“, die die antioxidative und antimikrobielle Kraft von Propolis detailliert beschreiben, wird klar, dass die ägyptischen Heiler mit ihrer Anwendung dieses Stoffes ihrer Zeit um Jahrtausende voraus waren.

Bildquelle: Tutanchamun – Wikipedia
Diese tiefe Verbindung zu Reinheit, Heilung und Bewahrung führte die Bedeutung von Honig und Bienen schließlich über die irdische Welt hinaus. Sie wurden zu einer heiligen Brücke in die Ewigkeit. Als essentielle Grabbeigabe, wie in Tutanchamuns Grab gefunden, sollte der Honig die Verstorbenen auf ihrer gefährlichen Reise ins Jenseits nähren und die Gunst der Götter sichern. Er war die Nahrung der Unsterblichkeit, das süße Versprechen auf ein Leben nach dem Tod.
Das alte Ägypten, eine der strahlendsten Zivilisationen der Geschichte, wäre ohne die humble Biene in ihrer vollen Pracht nicht denkbar gewesen. Sie war Gottessymbol, Apotheke, Luxus Lebensmittel und Jenseitsführer in einem. Wenn wir also heute das letzte unverderbliche Lebensmittel der Antike bestaunen, blicken wir nicht nur auf ein historisches Kuriosum, sondern auf das Fundament einer Welt, die auf dem Rücken der heiligen Bienen des Pharao erbaut wurde.
„Verwechslung ade!“
Wer sticht wirklich?
Biene, Wespe, Hornisse im schnellen Vergleich

Der kompakte Herbst-Guide zum Erkennen, richtigen Verhalten und sicheren Miteinander
Wichtig vorab: Honigbienen stechen Menschen im Freien so gut wie nie! Fern vom Bienenstock haben sie keinen Grund dazu. Ein Stich passiert meist nur, wenn eine Biene eingeklemmt oder gequetscht wird (zum Beispiel unter Kleidung) oder wenn man versehentlich auf sie tritt. Das ist selten, denn Bienen sitzen fast immer auf Blüten, am Boden sind sie nur kurz beim Trinken am Uferrand oder direkt vor dem Stock. Viele Stiche, die man der Biene zuschreibt, stammen in Wirklichkeit von Wespen.

In 5 Sekunden unterscheiden
Honigbiene: rundlicher Körper, sichtbar behaart, braun-golden, oft mit Pollenhöschen. An Blüten unterwegs, kaum am Kuchen.
Wespe: glatt und glänzend, hartes Schwarz-Signal Gelb, schlanke Wespentaille. Im Spätsommer gern an Süßem und Deftigem.
Hornisse: deutlich größer (bis etwa 2,5 cm), Orange – Rotes Gesicht, Gelblich/Signalfarben Körper. Meidet süßes Essen, jagt Insekten.
Hummel: sehr rund und dicht behaart, gemütliches Brummen, friedfertig.
Wer sticht wann?
Biene: fern vom Stock fast nie, Ausnahmen sind Einklemmen, Drauftreten.
Wespe: im Spätsommer deutlich forsch, häufigster Tischgast und damit häufigster Stichverursacher.
Nicht fuchteln, ruhig bleiben! Bleibt das Insekt, langsam weggehen. Schlechte Nachricht…die Wespen haben Späher, die bei Futterfund rasch weitere Tiere anlocken. Das heißt Picknick, oder romantische und ruhige Abendessen ist oft vorbei sobald eine Wespe bei Ihnen Futter für sich findet.
Hornisse: meist friedlich, sticht vor allem bei Nestnähe und Bedrohung.
Hummel: sehr tolerant, sticht fast nur bei massiver Neststörung oder Bedrohung.
Warum Wespen im Herbst auffallen?
Wespenvölker sind jetzt am größten, die Larvenaufzucht läuft aus, Arbeiterinnen suchen Zucker und Eiweiß. Viele Arten jagen andere Insekten, nehmen aber auch Aas und Abfälle an. Darum interessieren sie sich für Wurst, Grillgut, Müll und Fallobst.
Gesundheitsrisiko realistisch
Typisch sind Schmerz, Schwellung und bei entsprechend veranlagten Personen allergische Reaktionen bis Anaphylaxie.
Weil Wespen auch an Aas und Abfällen fressen, können sie Umweltkeime am Körper oder Stachel tragen. Gute Hygiene nach Stichen ist sinnvoll: sauber halten, kühlen, beobachten.
Herbst-Tipps, die 90 Prozent aller Situationen lösen
1. Getränke abdecken, lieber durchsichtige Gläser als Dosen um zu sehen was sie trinken gerade. Auch bei Eis essen immer hinschauen. Vor meinen Augen hat mein Bekannte Ein Stück Eis zusammen mit eine Wespe gegessen mit eine sehr schmerzhafte Erfahrung.
2. Ruhe bewahren: nicht pusten, nicht rum schlagen.
3. Essensreste zügig wegräumen, Müll und Kompost schließen, Fallobst aufsammeln.
4. Abstand zu Nestern halten.
5. Für Kinder: Becher mit Deckel und Strohhalm, ruhige Bewegungen üben.
Erste Hilfe – und wann 112
Stachel (bei Bienen) zügig entfernen, kühlen (Tuch, kalte Umschläge).
Stich im Mund- oder Rachenraum: sofort 112 anrufen, von innen Eis lutschen, außen kühlen!
Anzeichen einer schweren allergischen Reaktion wie Atemnot, Schwindel, Kreislaufprobleme oder großflächige Quaddeln – 112 anrufen, Allergikerinnen und Allergiker verwenden ihr verordnetes Notfallset!
Als Empfehlung wenn keine Fachhilfe da ist wie z.B. im Ausland / in der Wildnis. Bei o.g. Symptomen (Besser als überhaupt nichts) freiverkäufliche und bekannte Antiallergikum verwenden welchen man immer logischerweise auch aus anderen Gründen immer dabei haben soll.

„Kampf der Süßen Kronen“
Premium-Honige im Vergleich
Eine kleine Kulturgeschichte von Wald, Tanne, Manuka und Heidehonig mit dem Blick über den Tellerrand
Vorweg: Wald-, Tannen- und Heidehonig waren nicht nur Delikatessen. In Klöstern und der Volksmedizin galten sie als heilkräftig für Atemwege, Haut und Wunden. Heute werden eigens aufbereitete, steril hergestellte Honige als medizinische Produkte in der Wundversorgung eingesetzt und sind in Apotheken erhältlich.
Waldhonig erzählt von einer Zeit, in der Imkerei eine Waldkultur war. In alten Eichen und Kiefern höhlte man Stämme aus, hing Klotzbeuten auf. Aus dem Handwerk der Zeidler wurden Zünfte, Rechte und Pflichten. Honig und Wachs hatten Abgabenwert: Wachs erhellte Kirchen, Honig süßte Feste und würzte das Brot der Städte. Aus Honigtau, dem zuckerreichen Saft, den Läuse auf Fichten, Tannen oder Eichen hinterlassen entsteht der dunkle, mineralische Waldhonig. Harzig im Duft, mit langem, klaren Nachhall. Gelingt ein Tannentau-Jahr, wird daraus Tannenhonig balsamisch, nobel und selten. Nicht selten schimmert Waldhonig perlmuttfarben, zart ins Grüne was hin und wieder auch bei mir vorkommt. Ein feines Jahrgangszeichen, das Kennerinnen und Kenner schätzen.
Auch in Osteuropa und der ehemaligen Sowjetunion erhielt dieses „dunkle Gold“ ein eigenes Kapitel. Ab den 1920er-Jahren bündelte das landesweit bekannte Fachmagazin Pchelovodstvo (Imkerei) Methoden, Studien und Praxiswissen. Institute und große Waldregionen beschrieben Leitfähigkeit, Mineralstoff- und Eiweißgehalt, Pollenbilder und Authentizitätsmerkmale von Honigtauhonigen. In den waldreichen Gebieten des Urals und der Bashkirischen Republik blieb zudem die Baumimkerei lebendig, eine Praxis, die den Wald als Lebensraum achtet und meist nur einmal im Spätsommer in die Vorräte eingreift. So blieben Handwerk, Waldökologie und Honigqualität eng verwoben.
Heidehonig ist Spätsommer im Glas.
Die Besenheide liebt mageren Boden, Wind und Licht. Wenn sie blüht, beginnt eine kurze, intensive Tracht. Der Honig ist thixotrop, in Ruhe gelartig, beim Rühren kurz fließend, dann wieder fest. Das macht die Ernte zur Handarbeit….Häufig wird er gepresst statt geschleudert. Im Geschmack wirkt er malzig, würzig, mit rötlichem Schimmer. Seine Erzählfäden reichen in den Norden: Honig war die Seele des Mets, des Fest- und Ritualtranks. Um die Heidenorde kursierten Geschichten bewahrter Rezepturen.Sicher ist vor allem dies: Heide prägte den Geschmack ganzer Regionen und tut es bis heute. Auch die Landschaft gehört zur Geschichte: Hüteschafe, Pflegefeuer und traditionelle Nutzung hielten Heiden offen und ermöglichten diese besondere Tracht.
Was Wald/Tanne und Heide eint, ist ihre Dunkelheit, und damit oft ihre innere Kraft. Dunkle Honige bringen mehr Mineralien, einen hohen Leitwert und reichlich Polyphenole mit. Das schenkt Tiefe, Struktur und erklärt, warum beide so gut zu gereiftem Käse, Wild, Sauerteig oder kräftigen Saucen passen. Hinter der Sinneseindrücklichkeit steckt greifbare Biochemie: Polyphenole wie Flavonoide und Phenolsäuren fangen in Labortests freie Radikale ab. Für den Menschen tragen sie zur gesamten Antioxidantienzufuhr der Ernährung bei und können Oxidation empfindlicher Moleküle (etwa Fette) bremsen. Kein Heilversprechen, aber ein nachvollziehbarer Baustein einer vielseitigen Kost. Auch Honig-Enzyme spielen mit. Wird Honig leicht verdünnt, setzt die Glucose-Oxidase in kleiner, anhaltender Menge Wasserstoffperoxid frei. Teil der antimikrobiellen Grundausstattung. Der hohe Leitwert wiederum spiegelt die Mineralien wider, vor allem Kalium, dazu Magnesium, Calcium, Phosphat und Spurenelemente. Sensorisch gibt das Tiefe, Länge und dieses feine, fast umamiartige Mundgefühl. Ernährungsphysiologisch liefern dunkle Honige in kleinen Portionen spürbar mehr Elektrolyte als viele helle Sorten. Man könnte sagen: Der Leitwert schmeckt, und er steht für Substanz. Zusammengenommen erklärt das, warum diese Honige so „erwachsen“ wirken: Antioxidative Kapazität, Enzymaktivität und Mineralien greifen wie Zahnräder ineinander.
Über das Meer geblickt, wartet eine andere Honiggeschichte: Manuka. Berühmt durch eine besondere, MGO-basierte antibakterielle Aktivität, hat er seine Nische. Doch der Schritt vom Naturprodukt zur globalen Premium-Ware bringt Schatten mit sich. In Teilen der Produktion sind Kunststoff-Mittelwände und -Rahmen verbreitet, aber weit entfernt vom materialehrlichen Handwerk mit Holzrahmen und rückverfolgbaren Wachswaben.
Im Video ist zu sehen, wie der Kunststoff sogar brennt und am Rand schmilzt möchte man so etwas wirklich in Verbindung mit Lebensmitteln haben? Und das ist nur ein Beispiel dafür, wie solche Mittelwände in der Praxis tatsächlich verwendet werden. So oder so hat thermisch beanspruchter Kunststoff im Bienenstock nichts zu suchen.
Thermisch beanspruchte Kunststoffe stehen häufig in der Kritik, weil bei Überhitzung Zersetzungsprodukte entstehen können. Im diesen Fall betrifft das besonders Kunststoff-Rämchen mit Plastikmittelwände , die beim Auftragen von Wachs zwangsläufig erhitzt werden.
Hinzu kommen lange Transportwege, intensive Vermarktung und Lizenzsysteme. All das treibt die Kosten, und in einem weltweiten Markt steigt der Druck zu Fälschungen und Misskennzeichnungen. So klettern Endpreise bisweilen in Höhen, die eher nach Marketing als nach Landschaft klingen.

Darum richtet sich der Blick wieder näher heran auf die dunklen Tropfen aus Wald, Tanne und Heide. Sie brauchen keine Fernlogistik und keine Plastiksysteme, um zu überzeugen. Ihr „Premium“ steckt im Jahrgang, verwendete Materialien, im Wetter, in der Natur und Imkerhand. Im leisen Perlmutt-Schimmer und im langen Nachhall am Gaumen. Wer im Glas mehr sucht als Süße, findet hier Landschaft, Handwerk und Geschichte und die leise Erinnerung, dass Honig Genuss- und Heiltradition zugleich sein kann. Medizinisch aufbereitet in der Praxis, als Tischhonig im Alltag, stets mit einer Geschichte, die draußen beginnt, im Wald und auf der Heide.

„Durstfalle Landwirtschaft – Wie Bienen beim Wasserholen sterben“
Die Bienen, jene fleißigen Wasserträgerinnen des Bienenstaates, gehen bei ihrer Suche nach Wasser mit großer Vorsicht vor. Fließende Bäche und rauschende Wasserläufe meiden sie lieber, zu groß ist die Gefahr, dabei zu verunglücken. Stattdessen zieht es sie zu feuchten Moospolstern, an die Ränder von Pfützen oder zu kleinen, stillen Teichen, die von Wasserpflanzen umgeben sind. Diese stehenden Gewässer haben für die Bienen nicht nur den Vorteil der Sicherheit, sie enthalten auch wertvolle Mineralstoffe und Stickstoff, die für ihren Stoffwechsel und die Entwicklung ihrer Brut unerlässlich sind.
Doch was als Lebensquelle dient, kann mitunter zur tödlichen Falle werden.

Bilquelle: uzbloknot.com
Die Gefahr im Guttationstropfen
Manche Pflanzen wie der industriell angebaute Mais geben in den frühen Morgenstunden sogenannte Guttationstropfen ab. Dabei handelt es sich nicht um Tau, sondern um Pflanzensaft, der durch Wurzeldruck an den Blatträndern austritt. Diese Tropfen wirken für Bienen wie ein willkommenes Wasserangebot. Doch bei genmanipuliertem oder mit Pestiziden behandeltem Mais enthalten sie mitunter Pestizidkonzentrationen, die tausendfach über der tödlichen Dosis für Bienen liegen. Ein einziger Tropfen kann ausreichen, um eine Sammlerin in kürzester Zeit zu töten.
Auch andere großflächig angebaute Monokulturen, etwa Rapsfelder, stellen eine ähnliche Gefahr dar. Wird Raps mit Glyphosat oder vergleichbaren Herbiziden behandelt, können sich auch in seinen Guttationstropfen oder auf den Pflanzenoberflächen Rückstände befinden, die für Bienen toxisch sind. Besonders problematisch: Diese Felder blühen oft zur gleichen Zeit, in der Bienen intensiv auf Nahrungssuche sind. Die Insekten fliegen sie gezielt an nicht ahnend, dass Nektar, Pollen oder Wasser auf den Blättern tödliche Stoffe enthalten können.
Die Zeiten, in denen Bienen noch bedenkenlos aus jeder Pfütze trinken konnten, scheinen endgültig vorbei.
Warum trinken Bienen überhaupt giftiges Wasser?
Forscherinnen wie Gabriela de Brito Sanchez vom CNRS in Toulouse haben sich diese Frage gestellt. In Experimenten setzten sie Bienen verschiedenen Flüssigkeiten aus: einer süßen Zuckerlösung und einer bitter-salzigen Substanz. Solange die Wahl bestand, entschieden sich die Tiere stets für die süße Variante. Doch wenn sie keine Alternative hatten, nahmen sie selbst jene Flüssigkeiten auf, die sie zuvor gemieden hatten, unabhängig davon, wie hungrig oder energiearm sie waren.
Diese Verhaltensweise deutet auf ein fundamentales Problem hin: Nicht die Unkenntnis der Gefahr treibt die Bienen zum Gift, sondern das Fehlen sicherer Alternativen.
Der Mangel an sauberem Wasser und vielfältiger Nahrung zwingt sie zu riskanten Entscheidungen. Sie trinken giftige Tropfen, weil sie keine andere Wahl haben. Die moderne Landwirtschaft mit ihren Monokulturen, sei es Mais, Raps oder andere Nutzpflanzen, raubt ihnen nicht nur die Vielfalt, sondern auch die Sicherheit. Pestizidrückstände, Herbizide wie Glyphosat und der Rückgang unberührter Natur zwingen sie, buchstäblich ihr Leben zu riskieren, und damit auch das ihrer gesamten Kolonie.

„Blütenflüstern“
Warum Bienenmädels nicht auf Rosen stehen
Zwei Realitäten nebeneinander
Im selben Garten existieren zwei Welten. Unsere farbenfrohe, vertraute Realität und die für Bienen unsichtbare, aber real leuchtende Dimension aus UV-Signalen. Wo wir eine gelbe Blume sehen, erkennt die Biene einen kontrastreichen, signalstarken Wegweiser. Und wenn wir eine rote Blume bestaunen, ignoriert sie sie, weil sie für sie dunkel wirkt.
Rote Blumen wirken für die Bienen düster und meist uninteressant. Kein Wunder also, dass viele bestäubungsabhängige Pflanzen eher bläuliche, violette oder gelblich-grüne Töne bevorzugen, die die Bienen gut sehen. Studien zeigen, dass Bienen UV-Muster beim Landen bevorzugen sie finden schneller zum Nektar und landen gezielter.
Farben sind nicht einfach nur schön – sie sind Nachrichten. Aber wer sie empfängt, entscheidet darüber, was sie bedeuten. Für uns Menschen deckt das sichtbare Spektrum Licht zwischen etwa 380 und 740 Nanometern ab. Diese Spanne umfasst Violett, Blau, Cyan, Grün, Gelb, Orange und Rot – und unser Gehirn kann darüber hinaus Mischfarben wie Rosa oder Magenta erzeugen.
So sieht Löwenzahn für die Bienen und uns Menschen aus

Blüten, die für uns „einfarbig“ erscheinen, tragen oft unsichtbare UV-Muster. Diese Muster fungieren als Leuchtpfade – Bullaugen, Pfeile oder Kontrastflächen, die die Biene zum Nektarzentrum leiten. Für uns ein schlichtes Gänseblümchen, für die Biene ein hell leuchtender Korridor mit Abschlussleuchte. Diese UV-Markierungen sind das Resultat einer Ko-Evolution zwischen Pflanzen und ihren Tierbestäubern.
Beim Fotografieren mit UV-Kameras sehen wir dann ein Wunder. UV-Muster, die aussehen wie geheime Tinte der Blumen. Anders als im Biologiebuch wirkt es wie Magie und wir verstehen, wie wichtig diese Signale sind
Bienen bewegen sich in einem anderen Farbraum: Sie sehen Ultraviolett (UV) im Bereich von 300 bis 400 nm, sowie Blau zwischen 430 und 470 nm, und Grün zwischen 520 und 560 nm. Rot und Orange liegen außerhalb ihrer Wahrnehmung – diese wirken für Bienen eher wie Dunkelgrün bis Schwarz. Dafür taucht UV auf, eine Farbe, die uns komplett verborgen bleibt.
Unser Farbspektrum:
Farbe Wellenlänge (nm)
Violett 380–450
Blau 450–495
Cyan 485–500
Grün 500–570
Gelb 565–590
Orange 590–625
Rot 625–740
Diese Spektralfarben bauen wir im Kopf zusammen – so entstehen auch nicht-spektrographische Töne wie Braun oder Magenta.
Farbspektrum der Biene
Sichtbare Farben (Bienen) Wellenlänge (nm) Bedeutung
Ultraviolett (UV) 300–400 Stark sichtbar, leuchtet geheim
Blau 430–470 Klar erkannt
Grün 520–560 Wahrnehmbar
Rot / Orange / Gelb > 560 Schwarz bis Dunkelgrün
UV ist für uns unsichtbar, Rot dafür für Bienen.
Das heißt Farben sind immer subjektiv. Es gibt keine absolute Farb-Wirklichkeit nur unterschiedliche Perspektiven. In einem Garten voller Blüten leben parallel verschiedene Wahrnehmungswelten. Und das ist das Schöne an der Natur, sie ist nicht eindimensional, sie ist bunt, spannend und überraschend, egal, durch welche Augen wir schauen.
Zusätzlich dazu besitzen Bienen zwei große Facettenaugen mit tausenden winziger Einzelaugen („Ommatidien“) sowie drei Punktaugen zur Lichtorientierung. Jeder Ommatidium enthält Rezeptoren für UV, Blau oder Grün. So entsteht ein Mosaik ihrer Umgebung. Die chromatische Schärfe ist gering, aber Kontraste und Bewegungen erkennen sie schnell perfekt für einen flinken Flug durch die Sommerflora.
“ Metamorphose des Lichts „
Tief im Inneren eines Bienenstocks, verborgen in einer sechseckigen Wachswabe, beginnt ein Leben, das uns Menschen oft verborgen bleibt leise, unscheinbar und doch hochkomplex. Alles beginnt mit einem winzigen Ei, kaum größer als ein Staubkorn. Die Bienenkönigin hat es höchstpersönlich abgelegt, und mit ihm startet eine Entwicklung, die in der Insektenwelt ihresgleichen sucht

Nach genau drei Tagen schlüpft aus diesem Ei eine winzige, beinlose Larve, weiß, weich und gekrümmt. Sie sieht aus wie ein winziges Komma im dunklen Wachs, doch in ihr schlummern bereits die Anlagen einer flugfähigen Arbeiterin. Jetzt beginnt der große Hunger. Rund um die Uhr wird die Larve von Ammenbienen gefüttert mit einer speziellen Nährlösung aus Pollen, Honig und einem Hauch Gelee Royale. Was wie einfacher Brei aussieht, ist in Wirklichkeit eine hochwirksame Wachstumsformel der Natur.
In nur wenigen Tagen vervielfacht die Larve ihr Gewicht und zwar nicht doppelt oder dreifach, sondern um das 1.500-Fache! Sie wächst so schnell, dass sie sich ganze fünfmal häuten muss, weil ihre Haut schlichtweg zu eng wird. Forschende vergleichen dieses Wachstum mit einem Neugeborenen, das innerhalb einer Woche das Gewicht eines Elefanten erreicht nur eben in Miniaturform.
Hochwertige Proteine für den Zellaufbau
Vitamine und Mineralstoffe für Entwicklung, Immunfunktion und Nerven
Fettsäuren für Energie und gesunde Zellmembranen
Und spezielle Enzyme, die die Verdauung und den Stoffwechsel auf Hochtouren bringen
Diese Nährstoffe sind exakt auf das rasante Wachstum abgestimmt. Nichts ist dem Zufall überlassen.Die Natur liefert präzise das, was für Höchstleistung gebraucht wird
Auch bei uns ist Ernährung nicht bloß eine Mahlzeit sie ist ein biologischer Bauplan. Jede Zelle, jedes Organ, unsere Konzentration, unsere Energie und sogar unsere Stimmung hängen davon ab, was wir unserem Körper zuführen.
Wie bei der Bienenlarve ist unsere Ernährung entscheidend dafür, wie wir uns entwickeln, wie gut wir funktionieren und wie lange wir gesund bleiben
Am siebten Tag ist Schluss mit Fressen. Die Larve spinnt sich in einen hauchdünnen Kokon und verwandelt sich. Die Ammenbienen verschließen nun die Wabenzelle mit einer schützenden Wachsschicht. Im Inneren beginnt das eigentliche Wunder: die Metamorphose! Das komplette Larvengewebe wird aufgelöst und neu zusammengesetzt. Aus dem weichen Wurm entsteht Stück für Stück ein Insekt mit Augen, Flügeln, sechs Beinen und feinsten Haaren zur Wahrnehmung von Temperatur, Duft und Bewegung.

Nach insgesamt 21 Tagen ist es so weit. Die neue Biene ist fertig und bereit für das Licht der Welt. Mit ihren kräftigen Kiefern nagt sie sich durch den Zellverschluss und krabbelt zum ersten Mal hinaus in den Stock. Kaum draußen, wird sie von älteren Arbeiterinnen begrüßt. Sie berühren sie mit den Fühlern, tauschen Duftstoffe aus und „scannen“ sie buchstäblich mit ihren Antennen. Nur wer gesund ist, wird vollständig ins Volk integriert.
Kommunikation ist bei Bienen ein sinnliches Erlebnis. Düfte, Berührungen und feinste Vibrationen bestimmen, wie die Neuankömmling aufgenommen wird. Innerhalb weniger Stunden beginnt sie, erste Aufgaben zu übernehmen, etwa das Putzen leerer Wabenzellen oder das Wärmen der Brut. In den folgenden Tagen durchläuft sie eine Art „Bienen-Ausbildung“, bevor sie später als Sammelbiene hinausfliegen darf.
Was wie ein stilles, kleines Leben beginnt, ist in Wahrheit ein streng organisierter Entwicklungsprozess, eine perfekte Kombination aus Biologie, sozialem Verhalten und erstaunlicher Intelligenz. Wissenschaftler bezeichnen die Bienen deshalb nicht nur als Insekten, sondern als Teil eines Superorganismus „BIEN„, in dem jeder genau weiß, was zu tun ist.
Diese Entwicklung erinnert uns daran, wie faszinierend, komplex und perfekt die Natur ist und dass selbst in der kleinsten Wabe eine ganze Welt verborgen liegt, voller Geheimnisse, Wunder und Leben.

SUGAR FREE!
Warum ich meinen Bienen KEINEN Zucker füttere
In der heutigen Imkerei ist das Füttern mit Zuckerlösung leider fast selbstverständlich. Nach der Honigernte im Spätsommer oder bei Trachtpausen im Sommer greifen viele Imker zum Zucker, um die Völker mit Ersatznahrung zu versorgen. Das mag ökonomisch sinnvoll erscheinen – ich lehne es jedoch entschieden ab!

Was ist bei klassischen Imkereien üblich? Der Standard der Zuckerfütterung
Zumeist wird in zwei Situationen Zucker zugefüttert:
1. Im Spätsommer/Herbst, nach der Honigernte, erhalten die Völker bis zu 15–20 kg Zuckerlösung (Invertzucker, Sirup oder Kristallzucker mit Wasser), um ihre Wintervorräte aufzufüllen.
2. In Sommer-Trachtpausen, wenn keine Blüten verfügbar sind, wird Zucker gegeben, um den Brutbetrieb aufrechtzuerhalten und Schwächung zu verhindern.
Das klingt zunächst vernünftig – hat aber Schattenseiten, über die kaum gesprochen wird.
Meine Gründe gegen Zuckerfütterung
Verfälschung des Honigs – Zuckerreste können in den Vorräten landen. Zucker, der einmal im Stock ist, kann in Honigwaben eingetragen werden, besonders bei Frühjahrsbeginn oder bei erneuter Honigproduktion nach einer Trachtpause. So entstehen Honige mit Zuckerbestandteilen, die den rechtlichen Anforderungen nicht mehr entsprechen (Quelle: Honigverordnung; DIB-Leitfaden 2020).
Honig sollte rein bleiben – ohne Zuckerbeimischung!
Schimmelbildung durch massive Feuchtelast
Die übliche Zuckerlösung wird in Mischungsverhältnissen von 1:1 (50 % Zucker, 50 % Wasser) oder 3:2 (drei Teile Zucker, zwei Teile Wasser) gegeben. Das Problem liegt jedoch nicht nur im hohen Wasseranteil, sondern vor allem darin, dass die Bienen auf einmal mehrere Liter oder Kilo dieser Lösung verarbeiten müssen.
Im Gegensatz zur natürlichen Nektarsammlung bei der die Bienen nach und nach kleine Mengen verarbeiten und dabei kontinuierlich Wasser verdunsten, werden bei der künstlichen Fütterung große Mengen auf einen Schlag eingetragen. Diese müssen rasch eingedickt und gelagert werden. Dabei entsteht kurzfristig eine extreme Feuchtelast im Bienenstock.
Die Folgen:
Feuchtigkeit staut sich im Holz, an Rähmchen, Wänden und Deckeln
Schimmelbildung an Beutenteilen, Rämchen und sogar auf Honigwaben.
Störung des Stockklimas und Gefahr für Bienenkrankheiten. Diese Bedingungen fördern nicht nur Pilzbefall, sondern können auch hygienisch problematisch für den Honig werden, wenn der Zuckerstoffwechsel im Bienenkörper nicht stabil bleibt (vgl. Aumeier, Imkern leicht gemacht, 2022).

Räuberei – wenn Bienen zu Räubern werden
Zuckerlösungen verströmen einen intensiven Geruch und locken andere Bienenvölker an. Besonders in Trachtpausen oder bei schwachen Völkern kann das zur sogenannten Räuberei führen. Also fremde Bienen dringen in andere Beuten ein, stehlen Futter
Es kommt zu aggressiven Kämpfen und ganze Völker oder sogar Königinnen können dabei zugrunde gehen.
Zucker verändert das Verhalten der Bienen
Zuckerfütterung hat Einfluss auf das Sozialverhalten und die Kommunikation der Bienen. Studien zeigen, dass:
die Futtertänze reduziert werden, da keine echte Nektarquelle vorhanden ist
die Orientierung und Sammelstrategie gestört werden
das Putzverhalten und Hygieneverhalten sinkt, was das Risiko für Krankheiten wie Nosema oder Faulbrut erhöht
(vgl. Tautz, Die Honigfabrik, 2020)
Zucker bietet zwar Kalorien, aber keine Enzyme, Mineralien oder bioaktiven Stoffe, wie sie in echtem Honig enthalten sind. Die Bienen leben auf einem defizitären Nährstoffniveau, das langfristig zu Schwächung und Verhaltensänderung führen kann.

Was ich stattdessen mache
Ich ernte nur den Überschuss aus extra dafür vorgesehenen und aufgestellten Honigräumen. Mehr als genug Honig aus zwei Zargen bzw. Bruträumen bleibt immer unberührt für die Bienen da!
Ich überwintere meine Völker auf eigenem Honig.
Bei Trachtpausen greife ich in Bruträumen nicht ein. Die Bienen haben Reservewaben mit natürlichem Honig, auf die sie zurückgreifen können.

Weniger Profit – mehr Verantwortung!
Wer Honig erntet, trägt Verantwortung für die Bienen, für die Natur und für das Produkt selbst.
Zuckerfütterung mag wirtschaftlich erscheinen, doch sie hat langfristige Konsequenzen für das Wohl der Bienen und die Reinheit des Honigs.
Ich verzichte bewusst auf maximalen Ertrag, weil ich glaube:
Ein echter, hochwertiger Honig entsteht nur dann, wenn wir den Bienen ihre natürliche Nahrung lassen.
Das bedeutet:
Keine künstliche Zuckerlösung
Keine Honigentnahme aus dem Brutraum
Keine Kompromisse bei der Qualität
Kein Schimmel in der Beute oder im Honig
Keine Schwächung durch Krankheiten, die durch den Stress und künstliche Fütterung entstehen
Keine unnötige Arbeit mit überschüssiger Feuchtigkeit und deren Folgen
Wir Imkerinnen und Imker entscheiden täglich, welche Art von Produkt wir erzeugen, und wie wir mit unseren Bienen umgehen.
Ich entscheide mich für Ehrlichkeit, Natürlichkeit und ein Produkt, das diesen Namen verdient HONIG zu sein.

„Wenn Flügel ruhen und die Waben flüstern“
Wenn die Sonne langsam hinter den Bäumen verschwindet und der letzte Lichtstrahl golden auf die Wiese fällt, kehrt auch im Bienenstock allmählich Ruhe ein. Es summt leiser, die hektische Geschäftigkeit des Tages legt sich, und zwischen Wabe und Wabengang geschieht etwas, das lange Zeit kaum jemand vermutete – Die Bienen schlafen.
Ja, sie schlafen wirklich. Nicht wie wir – in Betten und mit geschlossenen Augen – aber sie tun es. Und auf ihre ganz eigene, faszinierende Weise.
Die stille Seite des Bienenlebens
Schlaf war lange ein Thema, das in der Forschung über Bienen kaum Beachtung fand. Wie sollten so kleine, immer emsige Tiere überhaupt zur Ruhe kommen? Doch in den 1980er-Jahren beobachtete ein Biologe namens Walter Kaiser etwas Unerwartetes. Einzelne Bienen wurden plötzlich still. Sie hörten auf, ihre Fühler zu bewegen, senkten ihren Körper leicht ab, klappten die Flügel zur Seite – und blieben einfach ruhig. Minutenlang. Manchmal sogar eine halbe Stunde.
Auch neuere Forschungen z. B. vom Max-Planck-Institut oder der University of Illinois haben Schlafphasen, Hirnaktivität und Verhalten detailliert untersucht. Mit modernen Techniken wie Infrarotaufnahmen oder RFID-Tracking konnten Forscher zeigen, wann und wie lange einzelne Bienen schlafen.
Das war der Anfang der Erkenntnis Auch Bienen brauchen Schlaf.
Wie schläft eine Biene?
Eine schlafende Biene ist ein Bild von Ruhe. Ihre Fühler zucken kaum, ihre kleinen Beine knicken ein, und oft hängt sie sogar kopfüber an einer Wabe – festgekrallt, aber ganz entspannt. Ihre Muskeln ruhen, ihre Reaktionszeit verlängert sich. Und auch wenn sie keine Augenlider haben, so ist doch klar Ihr Geist ruht.
Einzelne Bienen schlafen unterschiedlich, je nach Aufgabe.
Junge Bienen, die im Inneren des Stocks putzen, füttern oder bauen, machen häufig kurze Nickerchen – verteilt über den Tag.
Sammelbienen, die tagsüber Blüten anfliegen, schlafen vor allem nachts, oft bis zu 6–8 Stunden.
Die Bienenkönigin, Zentrum des Stocks, schläft unregelmäßig – in kleinen Pausen zwischen dem Eierlegen.
Genau wie beim Menschen ist der Schlaf für Bienen nicht nur Erholung, sondern lebensnotwendig für ihre geistige Leistungsfähigkeit.
Müde Bienen verlieren die Orientierung und finden schwerer zurück in den Stock.
Ihre berühmte „Tanzsprache“, mit der sie anderen Bienen Blütenstandorte zeigen, wird ungenau und fehlerhaft, wenn sie übermüdet sind.
Duft- und Blütenerinnerungen lassen sich schlechter speichern – das Gedächtnis braucht die nächtliche Ruhe zum Sortieren.
Nach außen scheint der Bienenstock nie still zu stehen. Doch in seinem Inneren herrscht abends eine spürbare Veränderung. Das Geräusch der summenden Flügel wird leiser, das Tempo der Bewegung langsamer. Es wird getuschelt statt getobt, gearbeitet wird im Flüstermodus. Manche Bienen dösen am Rand der Wabe, andere klammern sich wie winzige Schläfer an Holz oder Wachskante.
Fun Fact
Bienen schnarchen nicht – aber summen leise weiter
In Ruhephasen sind sie fast lautlos. Manche Forscher fanden sogar Unterschiede in der Vibrationsfrequenz zwischen wachen und schlafenden Bienen.

„Im Licht des Glaubens: Honig als geistliche Nahrung“
Honig als Zeichen des Göttlichen im Christentum, Islam und darüber hinaus
Honig – das goldene Geschenk der Natur. Für uns Imker ist er weit mehr als ein süßer Brotaufstrich. Er ist Ausdruck von Fleiß, Gemeinschaft, Geduld – und ja, auch von etwas Göttlichem.
Schon in der Bibel hat Honig einen besonderen Platz. Immer wieder begegnet er uns als Symbol für Fülle, Segen und göttliche Fürsorge. Wenn Gott dem Volk Israel das verheißene Land beschreibt, nennt er es „ein Land, in dem Milch und Honig fließen“ – ein Ort des Überflusses und des Lebens (2. Mose 3,8). Für die Menschen damals war Honig das Süßeste, was es gab – ein Vorgeschmack auf das Paradies.
Auch die Psalmen greifen dieses Bild auf: „Wie süß sind deine Worte meinem Gaumen, mehr als Honig meinem Mund!“ (Psalm 119,103). Wer je frischen Honig direkt aus der Wabe geschleckt hat, weiß, wie viel Wahrheit in diesem Vers steckt. Honig steht hier für das Wort Gottes – süß, stärkend, heilend.
Und dann ist da Johannes der Täufer – der Wegbereiter Jesu. In der Wüste lebt er von Heuschrecken und wildem Honig. Eine schlichte, naturnahe Kost. Vielleicht auch ein stilles Zeichen dafür, wie Gott in der Einfachheit gegenwärtig ist.
Sogar Jesus selbst begegnet dem Honig: Nach seiner Auferstehung isst er – ganz real, ganz irdisch – ein Stück Fisch und ein wenig Honig (Lukas 24,42-43). Ein Moment der Nähe, der zeigt: Der auferstandene Christus ist kein ferner Geist, sondern lebendig unter uns. Sogar der Honig hat Teil an diesem Wunder.

Der heilige Ambrosius – Patron der Imker
Besonders spannend für uns Imker ist auch die Geschichte des heiligen Ambrosius (ca. 339–397), Bischof von Mailand. Er gilt als der Schutzpatron der Imker, der Bienenzüchter – und das hat eine schöne Legende als Ursprung:
Schon als kleines Kind soll ein Bienenschwarm um seinen Mund geschwirrt sein und Honig auf seine Lippen getropft haben, ohne ihn zu stechen. Sein Vater sah darin ein Zeichen, dass sein Sohn einst ein großer Redner und Glaubenslehrer werden würde – „seine Worte würden süß wie Honig sein“. Und so kam es auch: Ambrosius wurde einer der einflussreichsten Kirchenlehrer der frühen Kirche.
Bis heute wird er oft mit einem Bienenkorb dargestellt. Er steht für Weisheit, Sanftheit und die Kraft des gesprochenen Wortes – ganz in der Art, wie auch Honig eine stille, aber starke Wirkung entfaltet.

Honig im Islam – eine heilende Gabe Allahs
Auch im Islam hat der Honig eine ganz besondere Bedeutung – sowohl als Heilmittel als auch als Zeichen göttlicher Schöpfung. Im Koran gibt es eine ganze Sure, die den Namen der Biene trägt: An-Nahl (Sure 16, „Die Biene“). Darin heißt es:
„Aus ihrem Leib kommt ein Trank von verschiedenen Farben, in dem Heilung für die Menschen liegt. Wahrlich, darin ist ein Zeichen für Leute, die nachdenken.“ (Koran, 16:69)
Honig wird hier direkt als heilsame Substanz beschrieben, die Allah den Menschen schenkt. Die Biene gilt als wunderbares Beispiel für Ordnung, Fleiß und göttliche Inspiration – denn laut Koran ist sie von Gott selbst „eingewiesen“, wo sie ihre Nahrung finden und wie sie ihre Waben bauen soll.
In der islamischen Medizin (Prophetische Medizin, Tibb an-Nabawi) spielt Honig eine wichtige Rolle als natürliches Heilmittel – innerlich und äußerlich angewendet. Der Prophet Muhammad (s.a.s.) empfahl Honig bei verschiedensten Beschwerden und sagte sinngemäß:
„Heilung ist in drei Dingen: im Aderlass, im Honig und im Schröpfen.“
(überliefert u.a. in Sahih al-Bukhari)
Für uns als Imker ist das ein wunderbarer Gedanke. Dass aus der Arbeit unzähliger kleiner Wesen etwas entsteht, das nicht nur den Körper nährt, sondern auch die Seele berührt. Vielleicht ist der Honig deshalb so besonders – weil in ihm ein Hauch des Himmels steckt.

Vom Knistern des Styropors zum Herzschlag des Holzes – Ein Plädoyer für Natürlichkeit in der Imkerei
In der modernen Imkerei stehen Imker vor der Wahl zwischen verschiedenen Materialien für Bienenbeuten. Während Styroporbeuten aufgrund ihres geringen Gewichts und ihrer guten Isolierung beliebt sind, gibt es gewichtige Gründe, die für die Verwendung von Holzbeuten sprechen – insbesondere im Hinblick auf die Gesundheit der Bienen und die Qualität des Honigs.
Die natürliche Umgebung der Bienen
Bienen sind seit Millionen von Jahren an natürliche Materialien gewöhnt. Holz bietet ein atmungsaktives, feuchtigkeitsregulierendes Klima, das Schimmelbildung reduziert und ein gesundes Mikroklima im Bienenstock fördert. Im Gegensatz dazu können Styroporbeuten bei unsachgemäßer Handhabung zu Kondenswasserbildung führen, was das Risiko von Schimmel erhöht – eine Bedrohung sowohl für Brut als auch für Honig

Eigene Beobachtungen: Wenn Bienen Materialien testen – und zernagen
Was mich letztlich vollends von Holz überzeugt hat, waren meine eigenen Beobachtungen in mehreren Versuchsanordnungen. Ich habe unterschiedliche Materialien wie Styropor, Hartschaumplatten, und mit Kunststoff beschichtete Dämmplatten direkt in der Nähe von Fluglöchern und im Inneren leerer Beuten platziert und Test Bienenbeuten für Ableger Hergestellt.
Erstaunlich, wie neugierig und aktiv die Bienen auf diese Fremdstoffe reagierten. Einige Materialien wurden regelrecht angefressen, zernagt und zerbröselt – besonders Styropor und dünne PU-Oberflächen. Die Bienen scheinen keine Hemmungen zu haben, Fremdstoffe durch ihre Kieferwerkzeuge zu erkunden. Und wenn sich kleine Partikel lösen, besteht die reale Gefahr, dass diese über die Fühler, Putzverhalten oder die Wachsverarbeitung in den Honig, Blütenpollen(Bienenbrot) oder die Brut gelangen.
Diese Beobachtung wird durch ähnliche Erfahrungen aus der Imkerpraxis untermauert. In der Schweiz wurde beispielsweise nachgewiesen, dass sich winzige Fremdstoffe wie Zellulose oder Plastikfasern im Honig finden lassen – zwar selten, aber vorhanden (vgl. bienen-nachrichten.de, 2019).
Chemie im Bienenstock? Lieber nicht.
Abgesehen vom Knabbern gibt es ein weiteres Risiko. Styropor und verwandte Kunststoffe dünsten chemische Substanzen aus, besonders bei Hitze. Diese Ausgasungen sind für den Menschen oft kaum wahrnehmbar, aber Bienen nehmen solche Stoffe über ihre sensiblen Antennen wahr und reagieren möglicherweise mit Stress oder verändertem Verhalten. Zudem kann es in schlecht belüfteten Beuten zur Ansammlung dieser Dämpfe kommen. Kein idealer Lebensraum für ein so sensibles Superorganismus-Wesen wie den Bienenstaat.
Die Bio-Imkerei als Wegweiser
Für Imker, die nach den Richtlinien der Bio-Imkerei arbeiten, ist die Verwendung von Holzbeuten ohnehin vorgeschrieben. Diese Richtlinien verlangen den Einsatz natürlicher Materialien – nicht nur wegen der Umwelt, sondern auch zum Schutz der Qualität des Honigs. Denn alles, was im Bienenstock verwendet wird, kann Einfluss auf das Endprodukt haben.

Zurück zur Natur – aus Erfahrung und Überzeugung
Die Entscheidung für Holzbeuten ist für mich nicht nur eine philosophische oder ökologische Haltung. Sie ist das Ergebnis persönlicher Beobachtung, praktischer Erfahrung und tiefem Respekt gegenüber den Bienen. Holz lebt, genau wie der Schwarm, den es beherbergt. Es atmet, isoliert sanft und vor allem: Es bleibt natürlich.
Ich wünsche mir, dass mehr Imker den Mut haben, zurück zur Wurzel zu gehen für die Gesundheit der Bienen, die Reinheit des Honigs und das Gefühl, wirklich im Einklang mit der Natur zu arbeiten.

Die Killerbiene
Eine tödliche Mischung aus Aggressivität und Ausdauer
Die sogenannte Killerbiene, wissenschaftlich als Afrikanisierte Honigbiene (Apis mellifera scutellata) bekannt, ist eine Hybridart, die durch die Kreuzung europäischer Honigbienen mit afrikanischen Bienen entstanden ist. Diese Bienen sind besonders für ihre extreme Aggressivität und ihr hartnäckiges Verteidigungsverhalten bekannt.
Die Killerbiene ist ein faszinierendes, aber gefährliches Insekt. Ihre Ausbreitung hat das Ökosystem beeinflusst und erfordert besondere Vorsicht. Dennoch spielt sie eine wichtige Rolle in der Natur, insbesondere bei der Bestäubung und Honigproduktion.
Herkunft und Verbreitung
Die Killerbiene wurde 1956 in Brasilien gezüchtet, um die Honigproduktion zu steigern. Doch einige Schwärme entkamen und verbreiteten sich rasend schnell über Süd- und Mittelamerika bis in den Süden der USA. Heute findet man sie in warmen Regionen wie Texas, Kalifornien und Arizona.
Verhalten und Gefährlichkeit
Höhere Aggressivität: Killerbienen greifen zehnmal schneller an als europäische Honigbienen.
Ausdauer: Sie verfolgen Eindringlinge über Hunderte Meter, oft in großer Zahl.
Stiche mit tödlicher Wirkung: Der Stich einer Killerbiene ist nicht giftiger als der einer normalen Honigbiene, aber durch die große Anzahl an Stichen kann ein Angriff lebensbedrohlich sein, insbesondere für Allergiker.
Anpassungsfähigkeit: Killerbienen überleben in tropischen und subtropischen Klimazonen und verdrängen oft andere Bienenarten.
Vorteile und Nutzen
Trotz ihrer gefährlichen Natur haben Killerbienen auch positive Eigenschaften:
Sie produzieren viel Honig.
Sie sind widerstandsfähiger gegen Krankheiten.
Sie tragen zur Bestäubung von Pflanzen bei.
Schutzmaßnahmen gegen Killerbienen
Nicht in der Nähe von Bienenstöcken lärmen oder schnelle Bewegungen machen.
Dunkle Kleidung vermeiden (Bienen reagieren darauf aggressiver).
Bei einem Angriff sofort rennen und Schutz in einem geschlossenen Raum suchen.

„Thermokiller – Die Verteidigerinnen des Himmels“
Die Verteidigungskunst der Bienen gegen übermächtige Gegner.
Wie Bienen töten, ohne zu stechen
Im goldenen Schein der Nachmittagssonne liegt der Bienenstock still und friedlich da. Von außen wirkt er wie ein Ort der Ruhe, summender Fleiß, der im Takt der Natur lebt. Doch hinter den Waben herrscht eine permanente Alarmbereitschaft – denn die friedlichen Honigbienen haben mächtige Feinde.
Die Bedrohung kommt nicht aus dem Inneren. Sie kommt von außen, lautlos und tödlich. Es sind Wespen und Hornissen – Räuber mit präzisen Waffen, auf der Suche nach Proteinen, Zucker und Chaos. Und im düsteren Schatten der Wälder lauert eine neue Gefahr: die Asiatische Riesenhornisse (Vespa velutina), ein invasiver Gigant mit mörderischer Effizienz.

Die Wächterinnen
Erste Verteidigungslinie.
An den Eingängen des Stocks postieren sich stets einige Bienen – die Wächterinnen. Sie tragen keine Uniform, keine Rangabzeichen, doch sie sind trainierte Kämpferinnen, spezialisiert auf Erkennung und Abwehr. Sie prüfen jede ankommende Biene auf ihren Duftcode, ein einzigartiges Pheromon, das sie vom eigenen Volk unterscheidet. Eindringlinge? Keine Chance. Jedenfalls fast.
Wenn sich eine Wespe nähert – schneller, wendiger, mit tödlichem Kiefer – reagieren die Bienen sofort. Sie attackieren in der Gruppe, umzingeln den Feind und versuchen, ihn von der Öffnung fernzuhalten. Gegen einzelne Wespen haben sie gute Chancen. Doch Hornissen? Das ist ein anderes Kaliber.

Die europäische Hornisse – stark aber nicht unbesiegbar.
Vespa crabro, die einheimische Hornisse, ist ein respekteinflößender Gegner. Sie kann eine einzelne Biene mit Leichtigkeit töten und trägt manchmal mehrere Tiere zur Brutfütterung ab. Aber, sie ist kein Massenmörder. Ihr Jagdverhalten ist punktuell, berechenbar – und für ein starkes Volk verkraftbar. Ihre Anwesenheit führt zur Alarmbereitschaft, aber nicht zur Panik.
Bienen versuchen, sie mit einem erstaunlichen Trick zu bekämpfen. Der sogenannten Wärmeball-Taktik. Mehrere Dutzend Arbeiterinnen stürzen sich auf die Hornisse, bilden eine dichte Kugel und erzeugen durch Muskelzittern eine Temperatur von über 45°C – gerade genug, um die Hornisse zu töten, ohne sich selbst zu verbrennen.
Eiweiße (Proteine) bestehen aus langen Ketten von Aminosäuren, die in einer bestimmten Form gefaltet sind – diese Struktur ist entscheidend für ihre Funktion. Wird die Temperatur zu hoch, denaturieren die Proteine, also sie entfalten sich, verlieren ihre Form und damit ihre Funktion. Wodurch das Tier sich nicht mehr bewegen oder verteidigen kann. Außerdem der enge Ball aus Bienen schränkt die Sauerstoffzufuhr zur Hornisse stark ein. In Kombination mit der Hitze entsteht ein doppelter Effekt: Hitzetod plus Ersticken.
Bienen selbst überleben das kurzzeitig, weil sie an diese Temperaturgrenzen evolutionär angepasst sind – ihre letale Temperatur liegt bei etwa 50 °C, also etwas höher als bei Hornissen oder Wespen. Es ist Biologie als Kriegsstrategie!
Die asiatische Hornisse – eine stille Invasion. Ganz anders verhält sich Vespa velutina. Diese aus Südostasien eingeschleppte Art ist aggressiver, effizienter und arbeitet in Gruppen. Ihre Taktik ist perfide, sie lauert vor dem Bienenstock, fängt heimkehrende Sammlerinnen ab und dezimiert das Volk systematisch. Einzelne Bienen können sich kaum wehren – und das permanente „Belagern“ führt oft zum Zusammenbruch der Verteidigung.

Die europäischen Honigbienen haben gegen diese neue Bedrohung kaum evolutionäre Abwehrmechanismen entwickelt. Während asiatische Bienenarten die Wärmeball-Taktik perfektioniert haben, fehlt diese Fähigkeit den hiesigen Völkern oft – oder sie setzen sie zu spät ein. Doch Bienen sind lernfähig. Studien zeigen, dass Völker mit Erfahrung im Umgang mit Vespa velutina beginnen, neue Strategien zu entwickeln: erhöhte Wachsamkeit, verändertes Flugverhalten, kollektives Abschrecken durch lauteres Summen oder gezieltes Attackieren. Was macht die Verteidigung so faszinierend? Bienen kämpfen nicht für sich. Keine Einzelne flieht. Sie kämpfen für den Stock, für die Königin, für das Überleben der nächsten Generation. Ihr Mut ist kollektiv – und manchmal tödlich. Eine Wächterin, die zusticht, opfert ihr Leben. Doch sie tut es in der Gewissheit, dass der Rest überlebt. Und vielleicht liegt genau darin das Geheimnis ihrer Widerstandsfähigkeit: In einer Welt voller Feinde haben Bienen keine Zeit für Egoismus. Ihre Kraft liegt in der Einheit – und in ihrer Fähigkeit, selbst die gefährlichsten Angreifer mit Mut, Intelligenz und Gemeinschaftssinn zu besiegen.

Die geheime Demokratie der Bienen
Ein Parlament ohne Worte
Wenn wir an Demokratie denken, stellen wir uns oft hitzige Debatten, Wahlurnen und Machtkämpfe vor. Doch eines der ältesten und reinsten demokratischen Systeme der Natur finden wir nicht in Parlamenten, sondern in den Bienenstöcken der Honigbienen.Ein Bienenschwarm ist kein chaotischer Haufen, sondern ein hochorganisiertes Kollektiv. Dort treffen Tausende Individuen gemeinsam Entscheidungen – effizient, präzise und ohne eigennützige Interessen. Doch wer trifft diese Entscheidung? Es ist nicht die Königin! Sie ist nur eine Gefangene ihres eigenen Volkes, eine Gebärmaschine, die dem Willen der Arbeiterinnen folgt. Die wahre Macht liegt im Schwarm selbst – in jenem unsichtbaren Netz aus Tänzen, Düften und Berührungen, das die Bienen seit Millionen Jahren perfektioniert haben.
Doch während Bienen eine perfekte Balance zwischen Gemeinschaft und Entscheidungsfreiheit finden, scheitern Menschen oft an Geiz, Machtstreben und individuellen Interessen. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir von der Natur lernen.
Die Kunst des Schwärmens.
Wenn ein Bienenvolk zu groß wird, steht ein Umzug an. Etwa zwei Drittel der Bienen verlassen mit der alten Königin den Stock und müssen eine neue Heimat finden. Die Wahl des neuen Nistplatzes ist ein Paradebeispiel für direkte Demokratie in der Natur.
Kundschafterbienen, sogenannte Speerbienen, erkunden verschiedene potenzielle Orte und kehren mit ihren Berichten in den Schwarm zurück. Diese Berichte geben sie in Form des berühmten Schwänzeltanzes weiter. Je besser ein Fundort, desto länger und intensiver der Tanz. Andere Bienen nehmen diese Information auf, untersuchen den Ort selbst und geben ebenfalls ihre Meinung ab. Nach und nach kristallisiert sich die beste Option heraus. Je mehr Bienen sich für eine bestimmte Wahl aussprechen, desto stärker wird der Schwarm in diese Richtung gelenkt, bis schließlich Konsens herrscht. Dieser Entscheidungsprozess, der durch Schwarmintelligenz funktioniert, sorgt dafür, dass Bienen fast immer die optimale Wahl treffen. Keine Biene setzt sich aus Eigennutz über die Entscheidung des Schwarms hinweg, niemand handelt aus Machtinteresse.
Nicht nur beim Schwärmen, sondern auch im täglichen Leben einer Bienenkolonie gibt es demokratische Prozesse. Bienen müssen laufend entscheiden, welche Nahrungsquellen am besten sind und welche Ressourcen gerade am meisten benötigt werden. Auch hier kommen wieder Speerbienen zum Einsatz. Sie erkunden die Umgebung und bewerten Pollen- und Nektarquellen nach Faktoren wie Energiegehalt und Entfernung.
Sobald eine vielversprechende Quelle entdeckt wird, kommunizieren sie das durch den Schwänzeltanz. Je ergiebiger die Quelle, desto leidenschaftlicher der Tanz – ein natürlicher Mechanismus, der dafür sorgt, dass sich immer mehr Sammlerbienen für die besten Ressourcen entscheiden. Doch diese Entscheidungen sind nicht starr. Sollte sich eine Quelle erschöpfen oder neue, bessere Optionen auftauchen, passt sich das Kollektiv flexibel an. So bleibt der Schwarm stets optimal versorgt. Auch hier geht es nicht um persönliche Bereicherung, sondern um das Wohl aller.
Nicht nur Bienen, sondern auch Menschen hatten in der Vergangenheit demokratische Systeme, die funktionierten. Ein Beispiel dafür sind die Wikinger. Sie praktizierten eine Form der direkten Demokratie auf ihren „Things“ – Volksversammlungen, bei denen freie Männer politische Entscheidungen trafen. Ein interessantes Abstimmungssystem war die Nutzung von Steinen. Jeder konnte seinen Stein in einen bestimmten Bereich legen, um seine Stimme für oder gegen eine Entscheidung abzugeben. Die Mehrheit entschied, und die Gemeinschaft hielt sich daran. Machtinteressen einzelner spielten eine untergeordnete Rolle – es ging um den Erhalt der Gemeinschaft.
Egoismus statt Gemeinschaft.
Während Bienen und Wikinger auf eine funktionierende Schwarmintelligenz oder basisdemokratische Abstimmungen setzten, ist die heutige Demokratie oft von Eigennutz, Lobbyismus und Machtstreben durchzogen. Geld regiert, politische Interessen werden von wenigen Eliten bestimmt, und demokratische Prinzipien werden durch wirtschaftliche Abhängigkeiten verwässert. Anstatt gemeinsam die beste Lösung zu finden, kämpfen Parteien und Individuen um ihren eigenen Vorteil.
Doch nicht nur auf staatlicher Ebene zeigt sich dieses Problem. Auch in Unternehmen, Familien und anderen Menschengruppen stehen oft individuelle Interessen über dem Wohl der Gemeinschaft. Statt kooperativ nach den besten Lösungen zu suchen, dominieren Hierarchien, Machtkämpfe und persönliche Vorteile. Dadurch entstehen Konflikte, Ineffizienz und Stillstand.
Was wir von den Bienen lernen können?
Echte Demokratie basiert auf einem kollektiven Austausch von Wissen und dem gemeinsamen Streben nach der besten Lösung für alle. Und genau das sollte auch unser Ziel sein – ob im Bienenstock, in Unternehmen, in Familien oder in unserer Gesellschaft.
Stellen Sie sich vor, unsere Gesellschaft würde wie ein Bienenschwarm entscheiden:
– Keine Machtkämpfe
– Keine Fake News
– Nur Fakten und kollektive Weisheit
– Keine Egos
– Keine Hierarchie
– Adaptivität. Wenn sich die Bedingungen ändern, wird neu entschieden.
Wenn alle Menschen sich an den Prinzipien der Bienen orientieren und kollektiv entscheiden, entwickeln sie sich als Gesellschaft viel schneller und nachhaltiger. Eine echte demokratische Entscheidungsfindung, die sich am Gemeinwohl orientiert, sorgt für mehr Fortschritt als egoistisches Handeln einzelner. In einer Gesellschaft, die auf Austausch und kollektive Intelligenz setzt, gibt es weniger Konflikte und mehr Fortschritt.

Von der Blüte zum Bienenwachs
Bienenwachs – ein Naturprodukt, das seit Jahrhunderten für seine Vielseitigkeit geschätzt wird. Ob als Grundlage für Kerzen, als Inhaltsstoff in Kosmetikprodukten oder als nachhaltige Alternative zu Plastik – Bienenwachs ist ein wahres Wunder der Natur. Doch wie genau entsteht dieses wertvolle Material? Und welche Rolle spielen die Bienen dabei? Bienenwachs ist ein echtes Naturwunder, das sowohl für die Bienen als auch für uns Menschen von unschätzbarem Wert ist. Die Entstehung dieses faszinierenden Materials ist ein komplexer Prozess, der eng mit dem Wohlbefinden der Bienen verbunden ist. Wenn wir die Bienen schützen, bewahren wir nicht nur die Artenvielfalt und unsere Umwelt, sondern auch dieses wertvolle Geschenk der Natur.
Die Bienen als Baumeisterinnen der Natur
Honigbienen sind nicht nur für die Bestäubung unserer Pflanzen und die Produktion von Honig verantwortlich, sondern auch für die Herstellung von Bienenwachs. Vor allem die jungen Arbeiterbienen, im Alter von etwa 12 bis 18 Tagen, besitzen spezielle Wachsdrüsen an der Unterseite ihres Hinterleibs. Diese Drüsen produzieren winzige Wachsschüppchen, die die Bienen mit ihren Mundwerkzeugen aufnehmen, kneten und formen, bis daraus das weiche, formbare Bienenwachs entsteht.
Mit diesem Wachs bauen die Bienen ihre charakteristischen sechseckigen Waben, die nicht nur als Vorratslager für Honig und Pollen dienen, sondern auch als geschützter Brutraum für den Nachwuchs. Die Wabenstruktur ist dabei nicht nur stabil, sondern auch ein perfektes Isolationsmaterial, das die Temperatur im Bienenstock konstant hält.
Der faszinierende Entstehungsprozess von Bienenwachs
Die Produktion von Bienenwachs erfordert jedoch ideale Bedingungen:
Eine Temperatur von etwa 35°C im Bienenstock
Ein starkes Bienenvolk mit reichlich Nektar- und Pollenquellen
Junge Arbeiterbienen, die aktiv Wachs produzieren.
Die Bienen wandeln die im Honig gespeicherten Kohlenhydrate in Wachs um. Die winzigen Wachsschüppchen, die anfangs farblos sind, werden durch den Kontakt mit Pollen und Propolis (Bienenharz) gelblich bis goldbraun.
Besondere Eigenschaften von Bienenwachs
Bienenwachs besteht aus einer komplexen Mischung aus Fettsäuren, Alkoholen und Kohlenwasserstoffen. Diese Zusammensetzung verleiht dem Wachs seine besonderen Eigenschaften: wasserabweisend, antibakteriell, formbar und langlebig.
Diese einzigartigen Eigenschaften machen Bienenwachs nicht nur für den Bienenstock unverzichtbar, sondern auch für uns Menschen in vielen Bereichen nutzbar.
Für die Bienen ist das Wachs lebensnotwendig: Es schützt die Brut, isoliert den Bienenstock und dient als Lager für Honig und Pollen. Doch auch wir Menschen profitieren von diesem Naturmaterial. Zum Beispiel in der Herstellung von Kerzen, Naturkosmetik (z.B. Lippenbalsam und Handcreme), nachhaltigen Verpackungsalternative (Bienenwachstücher), Holz- und Lederpflege, Heilmitteln in der Naturheilkunde

DIY-Tipp: Bienenwachstücher selber machen
Bienenwachstücher sind eine umweltfreundliche Alternative zu Plastikfolie und helfen, Lebensmittel frisch zu halten.
Du brauchst:
Ein Baumwolltuch
Bienenwachs (am besten vom Imker)
Ein Backblech und Backpapier
Anleitung:
1. Lege das Baumwolltuch auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech.
2. Verteile kleine Bienenwachsflocken gleichmäßig auf dem Stoff.
3. Im Backofen bei 90°C für etwa 5 Minuten schmelzen lassen.
4. Das flüssige Wachs mit einem Pinsel gleichmäßig verteilen.
5. Das Tuch auskühlen lassen – fertig!

„Du bist, was du isst“
Die Redewendung „Man ist, was man isst“ beschreibt treffend, wie stark unsere Ernährung unseren Körper und unsere Gesundheit beeinflusst. Hochwertige, nährstoffreiche Nahrung versorgt uns mit Energie, stärkt unser Immunsystem und beeinflusst sogar unsere Stimmung und mentale Leistungsfähigkeit. Wer sich gesund und ausgewogen ernährt, bleibt vital und leistungsfähig – wer sich hingegen von ungesunden, verarbeiteten Lebensmitteln ernährt, schadet seinem Körper langfristig.
Ein beeindruckendes Beispiel aus der Natur zeigt, wie mächtig die Ernährung tatsächlich ist: die Entstehung der Bienenkönigin durch Gelee Royale.
Beeindruckender Effekt von Gelee Royale zeigt sich in der Lebensdauer
Die Bienenkönigin
Die Bienenkönigin ist das Zentrum des Bienenstocks. Sie ist die einzige Biene, die Eier legt und so das Überleben des Volkes sichert. Doch sie wird nicht einfach geboren – sie wird gemacht! Die entscheidende Zutat in diesem Prozess ist Gelee Royale, ein spezieller Futtersaft, der aus einer normalen Arbeiterlarve eine Königin formt.
Wie entsteht eine Bienenkönigin?
Jede Honigbiene beginnt als Larve – und theoretisch könnte jede von ihnen eine Königin werden. Doch nur einige wenige erhalten das königliche Futter, das ihr Schicksal verändert !
1. Auswahl der Königinnenlarven
Wenn das Volk eine neue Königin braucht (etwa weil die alte stirbt oder ein Schwarm vorbereitet wird), wählen die Ammenbienen einige wenige Larven aus.
Diese Larven werden in besondere, größere Zellen gesetzt, die „Weiselzellen“ genannt werden.

2. Fütterung mit Gelee Royale
Während normale Arbeiterinnenlarven nur für die ersten drei Tage etwas Gelee Royale bekommen und dann auf eine Mischung aus Honig und Pollen umgestellt werden, erhält eine zukünftige Königin ihr gesamtes Leben lang ausschließlich Gelee Royale.
3. Die Wirkung von Gelee Royale
Gelee Royale ist ein hochkonzentrierter, nährstoffreicher Futtersaft, der von den Drüsen junger Arbeiterbienen produziert wird.
Es enthält Proteine, Vitamine (B5 & B6), Zucker, Fettsäuren und Hormone, die das Wachstum und die Entwicklung der Larve steuern.
Die entscheidende Veränderung: Durch die dauerhafte Fütterung mit Gelee Royale entwickeln sich die Eierstöcke der Larve vollständig, während normale Arbeiterinnen steril bleiben.

4. Die Metamorphose zur Königin
Nach 16 Tagen schlüpft eine Königin – schneller als Arbeiterinnen (21 Tage) oder Drohnen (24 Tage).
Sie ist größer, kräftiger und lebt bis zu 5 Jahre, während Arbeiterinnen oft nur wenige Wochen oder Monate überleben.
Der Kampf der Königinnen – nur eine kann überleben!
Wenn mehrere Königinnen schlüpfen, beginnt ein tödlicher Kampf um den Thron:
1. Tötung der Rivalinnen vor dem Schlüpfen
Die zuerst geschlüpfte Königin sucht die noch ungeschlüpften Königinnenlarven in ihren Waben und sticht sie ab, bevor sie überhaupt zur Konkurrenz werden.
2. Direktes Duell zwischen Königinnen
Falls zwei Königinnen gleichzeitig schlüpfen, kommt es zu einem Kampf auf Leben und Tod.
Mit ihren glatten Stacheln können sie mehrfach zustechen, ohne selbst zu sterben.
3. Schwarmbildung als Alternative
Manchmal verhindert das Volk den direkten Kampf, indem die alte Königin mit einem Teil der Bienen auszieht und einen Schwarm bildet, während die junge Königin den alten Stock übernimmt.

Die Königin nach dem Sieg
Nach dem Kampf muss die neue Königin sich paaren. Dazu begibt sie sich auf ihren Hochzeitsflug. Sie fliegt aus dem Stock und paart sich mit bis zu 20 Drohnen in der Luft. Die Drohnen sterben nach der Paarung, da ihr Fortpflanzungsapparat herausgerissen wird. Das gesammelte Sperma reicht für ihr ganzes Leben – sie kann Millionen von Eiern legen, ohne sich erneut paaren zu müssen.
Zurück im Stock übernimmt die Königin ihre Rolle: Sie steuert das Volk mit Pheromonen, legt täglich bis zu 2.000 Eier und sichert so das Überleben der Kolonie.
Ohne Königin kann ein Bienenvolk nicht lange überleben!

Die moderne Imkerei: Angst statt Verständnis?
Viele moderne Imker würden sich am liebsten in einen Kosmonautenanzug hüllen und einen Smoker mit elektrischer Düse anschaffen – aus Angst vor ihren eigenen Bienen. Doch hat das wirklich noch etwas mit echter Imkerei zu tun? Und was ist die Folge davon?
Wer Bienen nur als Produktionsmaschinen betrachtet, riskiert viel. Bei jeder Durchsicht werden unzählige Bienen zerquetscht, der gesamte Stock in Panik versetzt und das natürliche Verhalten der Bienen gestört. Das Ergebnis? Die Bienen werden zunehmend aggressiver.
Bienen sind hochintelligente Lebewesen, vergleichbar mit Hunden in ihrer Lernfähigkeit. Wenn sie bei jeder Durchsicht nur Stress erleben, verknüpfen sie die Anwesenheit des Imkers mit Gefahr – und reagieren mit Abwehrverhalten. Aggressive Bienenvölker sind jedoch oft ein hausgemachtes Problem, das durch übertriebene Schutzausrüstung und rücksichtslose Arbeitsweisen noch verstärkt wird.
Statt sich mit den eigenen Bienen auseinanderzusetzen und sie durch achtsames Arbeiten sanftmütig zu halten, setzen viele Imker auf eine vermeintliche „Lösung“: Sie kaufen Labor-gezüchtete F0- oder F1-Königinnen, die kurzfristig zahm erscheinen, aber die natürlichen Eigenschaften der Bienenvölker verfälschen.
Ich dagegen setze auf natürliche Zucht mit Bedacht – und konnte so bereits herausragende Ergebnisse erzielen, die ich bei keinem anderen Imker bisher gesehen habe. Indem ich mit den Bienen arbeite, anstatt gegen sie, schaffe ich eine Umgebung, in der Mensch und Tier harmonisch koexistieren können – ohne Angst, ohne Panik, und vor allem: ohne unnötige Eingriffe in die Natur.

Warum ich auf meinen Schutzanzug und Imkersmoker verzichte.
Das Imkern ist weit mehr als nur eine Methode zur Honiggewinnung – es ist eine Kunst, eine Beziehung zwischen Mensch und Biene. In der konventionellen Imkerei werden Schutzanzüge und der Imkersmoker als unverzichtbare Werkzeuge angesehen. Doch ich habe mich bewusst entschieden, auf beides zu verzichten. Warum? Weil ich glaube, dass es möglich ist, mit den Bienen in Harmonie zu arbeiten, ohne sie durch Rauch zu beunruhigen oder mich von ihnen durch dicke Schutzkleidung zu distanzieren.
Ohne Schutzanzug arbeite ich viel vorsichtiger und bewusster. Ich lerne, die Bienen besser zu verstehen, ihre Körpersprache zu lesen und meine Bewegungen so anzupassen, dass sie sich nicht bedroht fühlen. Diese Herangehensweise schafft Vertrauen – die Bienen spüren meine Ruhe und reagieren gelassener. Wer sich nicht hinter einem Schutzanzug versteckt, sondern sich wirklich mit den Bienen beschäftigt, entwickelt eine tiefere Verbindung zu ihnen.
Neue Arbeitsmethoden statt giftigem Rauch:
Viele Imker nutzen den Smoker, um die Bienen mit Rauch zu eine Brand zu simulieren, damit die Bienen sich panisch Honigvorrat holen und in der Zeit während Imker arbeitet abgelenkt sind. Doch dieser Rauch enthält oft krebserregende Stoffe, die sich im Wachs und damit langfristig auch im Honig anreichern können. Da der Wachskreislauf meistens geschlossen ist, und es werden danach neue Mittelwände für die Honigwaben damit hergestellt. So können sich Schadstoffe über die Jahre stark konzentrieren. Durch den Verzicht auf den Smoker schütze ich nicht nur die Bienen, sondern auch die Qualität meiner Bienenprodukte.
Um die Bienen nicht in Panik zu versetzen, habe ich alternative Methoden entwickelt: ruhiges Arbeiten, langsame Bewegungen und einiges mehr. So bleiben die Bienen entspannt, und ich kann in aller Ruhe meine Arbeit verrichten.
Natürliches Imkern erfordert Achtsamkeit
Wer ohne Schutzkleidung arbeitet zeigt, dass er seine Bienen wirklich mag und mit Respekt behandelt. Es ist ein Zeichen dafür, dass der Imker achtsam und vorsichtig mit seinen Tieren umgeht. Außerdem schwitzt man ohne Imkeranzug viel weniger was ebenfalls sehr positive Wirkung auf die Bienen und ruhige Arbeit hat. Als Imker Angst vor den eigenen Bienen zu haben, ist kein natürlicher Zustand – vielmehr sollte ein Imker lernen, wie er mit ihnen arbeitet, ohne dass es zu unnötigen Konfrontationen kommt.
Fazit:
Der Verzicht auf Schutzanzug und Smoker bedeutet nicht, dass ich leichtsinnig bin – im Gegenteil. Ich arbeite bewusster, vorsichtiger und nachhaltiger. Meine Bienenprodukte bleiben frei von giftigen Rückständen, und meine Bienen erleben weniger Stress. So wird das Imkern wieder zu dem, was es eigentlich sein sollte: eine respektvolle Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tier – ganz ohne Angst und ohne schädliche Hilfsmittel.
TABU Thema: „Giftblütenhonig“
Als Imker liegt mir nicht nur die Gesundheit meiner Bienen am Herzen, sondern auch die Qualität und Sicherheit des Honigs, den ich produziere. Dabei stoße ich immer wieder auf eine Problematik von Honig mit Glyphosat. Für mich ist klar, dass der Profit niemals über der Gesundheit von Menschen stehen darf. Doch leider wird diese Priorität in der Praxis oft vernachlässigt.

Glyphosat: ist ein weit verbreitetes Herbizid, gelangt über behandelte Pflanzen in den Nektar und Pollen, den Bienen sammeln. Dadurch kann das Gift in den Honig gelangen, ohne dass es viele Imker oder Verbraucher bemerken. Das Gefährliche daran ist, dass die meisten Honige nicht auf Glyphosat geprüft werden. Das bedeutet, dass viele Imker womöglich unbewusst belasteten Honig verkaufen und Kunden diesen Honig dauerhaft konsumieren können, ohne zu wissen, dass sie sich damit möglicherweise selbst vergiften.
Zwischen Fluch und Segen:
Imker, die ihre Bienenstände in der Nähe von chemisch behandelten Monokulturen wie Raps, Mais Kornblume usw platzieren (Bienentransport), oder stehen, stehen oft vor einem Dilemma. Einerseits bieten diese großflächigen Anbaugebiete einen enormen Honigertrag, da die Bienen auf engem Raum reichlich Nektar und Pollen finden. Dies kann für Imker ein Segen sein, da sie hohe Erträge erzielen und wirtschaftlich profitabel arbeiten können.
Doch andererseits ist diese Praxis ein Fluch, denn viele dieser Monokulturen werden mit Glyphosat nachbehandelt, um Unkraut zu bekämpfen. Dadurch spielen Imker, die ihre Bienen in solchen Gebieten stehen lassen, ein russisches Roulette: Ohne eine gründliche Laborprüfung wissen sie nicht, ob der gewonnene Honig belastet oder unbelastet ist. Sie riskieren, dass ihr Honig mit Glyphosat kontaminiert ist und somit eine potenzielle Gesundheitsgefahr für die Verbraucher darstellt.
Die Gefahr des unbewussten Konsums:
Honig wird oft als reines und gesundes Naturprodukt wahrgenommen. Doch wenn er mit Glyphosat belastet ist, wird aus diesem hochwertigen Lebensmittel eine Quelle für schädliche Chemikalien. Glyphosat steht im Verdacht, krebserregend zu sein, hormonelle Störungen zu verursachen und langfristige Schäden an Leber und Nieren hervorzurufen. Besonders bedenklich ist, dass diese Effekte oft erst nach Jahren oder Jahrzehnten auftreten, was es schwierig macht, den direkten Zusammenhang herzustellen.
Die Problematik fehlender Kontrollen:
Das größte Problem besteht darin, dass die meisten Honige aus „Risikogebiete“ bei Monokulturen nicht auf Glyphosat geprüft werden. Weder Imker noch Verbraucher haben daher eine klare Vorstellung davon, ob der Honig, der auf dem Tisch landet, tatsächlich frei von Schadstoffen ist. Als Imker trage ich eine Verantwortung dafür, sicherzustellen, dass mein Honig sicher und gesund ist. Doch viele Kollegen sehen diese Verantwortung nicht oder können sich die teuren Labortests schlichtweg nicht leisten. Das Ergebnis ist, dass belasteter Honig in Umlauf gerät und Verbraucher unbewusst Giftstoffe zu sich nehmen.
Dazu kommt die aktuelle Problematik mit gepanschtem Honig:
Ein weiteres gravierendes Problem ist die zunehmende Verbreitung von gepanschtem oder gefälschtem Honig, der häufig in Supermärkten und Discountern angeboten wird. Es geht dabei nicht nur um „Honige“ aus Asien, sondern allgemein um Honige aus so genannte EU und nicht EU Länder. Laut aktueller DNA-Analysen handelt es sich bei vielen dieser Produkte gar nicht um echten Honig, sondern um manipulierten Zuckersirup pflanzlicher Herkunft. Diese sogenannten „Honige“ werden so manipuliert, dass sie bei vielen Laboranalysen als echter Honig durchgehen. Also laut bewährte DNA Analyse handelt sich also nicht um echten Honig, sondern um ein Produkt, das gezielt so hergestellt wird, um die gängigen Prüfverfahren zu täuschen.
Dazu kommt, dass diese Zuckersirupe bestimmt noch nicht auf Rückstände von Pestiziden wie Glyphosat oder andere Chemikalien überprüft werden. Verbraucher, die solchen „Honig“ kaufen, erhalten daher nicht nur ein minderwertiges Produkt, sondern könnten auch unbewusst schädliche Chemikalien zu sich nehmen.
Hinzu kommt, dass viele Honige, die in Deutschland und der EU verkauft werden, aus anderen EU- und Nicht-EU-Ländern stammen. In einigen dieser Länder sind die Regelungen für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und anderen Chemikalien noch weniger streng als in Deutschland! Als Beispiel in Asien kämpfen viele um die Bienen und bestäuben sogar Bäume und andere Pflanzen per Hand da die Bienen vergiftet wurden. Glyphosat und andere starke Pestizide werden dort oft intensiv eingesetzt, was das Risiko einer Belastung deutlich erhöht. Da diese Honige jedoch als „echt“ deklariert werden und die Herkunft oft schwer nachvollziehbar ist, können Verbraucher nicht sicher sein, ob sie ein unbelastetes Produkt „Sirup- Honig“. kaufen.
Aus meiner Sicht ist es unerlässlich, dass Honigsorten, die mit Glyphosat in Berührung kommen können, regelmäßig auf Rückstände geprüft werden. Dazu gehören insbesondere Honige aus Regionen, in denen Monokulturen wie Raps, Kornblume, Mais usw angebaut werden, die häufig mit Glyphosat behandelt werden. Solche Honige sollten nicht nur stichprobenartig, sondern systematisch und in regelmäßigen Abständen kontrolliert werden. Nur so können wir sicherstellen, dass keine belasteten Produkte auf dem Tisch landen.
Regelmäßige Prüfungen würden nicht nur das Vertrauen der Verbraucher stärken, sondern auch Imker dazu anhalten, bewusster mit der Herkunft und Qualität ihres Honigs umzugehen. Es wäre ein wichtiger Schritt, um die Gefahr einer schleichenden Vergiftung durch Glyphosat-belasteten Honig zu minimieren.
Empfehlung an Kunden: Wie man Glyphosat-belasteten Honig vermeidet
Als Kunde kann man das Risiko, Glyphosat-belasteten Honig zu konsumieren, aktiv mindern. Hier sind einige Tipps:
- **Kauf beim Imker**: Beim Kauf von Honig direkt beim Imker sollte man nachfragen, ob der z.B. Rapshonig und andere Honigsorten von Monokulturen die mit Pestiziden behandelt werden auf Glyphosat geprüft wurde. Ein verantwortungsbewusster Imker wird transparent sein und Auskunft geben können.
Oder wenn man solche Honigsorten ganz meiden will:
- **Standort der Bienenstände**: Wenn man den Standort der Bienenstände kennt, sollte man darauf achten, dass im Umkreis von 2 bis 3 Kilometern keine mit Glyphosat behandelten Felder oder Monokulturen liegen. Bienen sammeln in diesem Radius, und je weiter sie von solchen Feldern entfernt sind, desto geringer ist das Risiko einer Belastung.
Honig aus Regionen mit hoher Biodiversität und wenig bis keiner intensiver Landwirtschaft ist oft weniger belastet. Regionale Imker, die auf Nachhaltigkeit setzen, sind eine gute Alternative. Unbedenklich aus meiner Sicht sind: solche Honigsorten wie Heidenhonig, Lindenhonig, Waldhonig und viele andere tolle Honigsorten die nicht mit Chemie belastet sind.
- **Regional und vielfältig**: 5. **Vorsicht bei Billig-Honig**: Besonders günstiger Honig aus dem Supermarkt, insbesondere sollte gemieden werden. Hier ist das Risiko hoch, dass es sich um gepanschten oder gefälschten Honig handelt, der möglicherweise ebenfalls mit Glyphosat belastet ist.
Für mich ist klar, dass die Gesundheit von Menschen und Bienen immer an erster Stelle stehen muss. Der Profit darf niemals wichtiger sein als die langfristigen Folgen für unsere Umwelt und unsere Mitmenschen. Deshalb setze ich mich dafür ein, dass mehr Imker ihre Honige auf Glyphosat und andere Schadstoffe testen lassen oder Glyphosat belastete Gebiete komplett meiden! Nur so können wir sicherstellen, dass unser Honig wirklich ein reines und gesundes Naturprodukt bleibt.
Als Imker, der bereits in die Imkerei investiert hat, sollte es selbstverständlich sein, auch in die regelmäßige Prüfungen des Honigs aus „Risikogebieten“ zu investieren. Schließlich geht es um die Gesundheit der Menschen, die diesen Honig konsumieren – sei es die eigene Familie oder die Kunden und deren Familien und deren Kinder.
Es ist schwer nachzuvollziehen, wie man mit ruhigem Gewissen Honig verkaufen oder sogar selbst verzehren kann, ohne sicherzustellen, dass er frei von schädlichen Substanzen wie Glyphosat ist. Kinder sind besonders gefährdet, da ihr Körper noch in der Entwicklung ist und sie empfindlicher auf Schadstoffe reagieren. Wenn wir als Imker Verantwortung übernehmen, dann müssen wir sicherstellen, dass unser Honig nicht nur lecker, sondern auch sicher und gesund ist.
Die Laborprüfungen von Honigen aus „Risikogebieten“ mag zunächst zusätzliche Umstände verursachen, aber sie ist ein essenzieller Schritt, um das Vertrauen der Kunden zu gewinnen und langfristig ein qualitativ hochwertiges Produkt anzubieten. Wer seinen “ Honig aus Risikogebieten“ nicht auf Schadstoffe prüfen lässt, riskiert nicht nur die Gesundheit seiner Mitmenschen, sondern auch den Ruf seiner Imkerei und das Vertrauen in das Naturprodukt Honig insgesamt.
Es ist unsere Pflicht als Imker, sicherzustellen, dass der Honig, den wir produzieren, den höchsten Standards entspricht. Nur so können wir mit gutem Gewissen sagen, dass wir unseren Beitrag zu einer gesunden Ernährung leisten und das Vertrauen in unsere Arbeit und in den Honig als Naturprodukt bewahren.
Es ist an der Zeit, dass wir Imker uns dieser Verantwortung bewusst werden und gemeinsam dafür sorgen, dass unsere Bienen und unsere Kunden vor den Gefahren von Glyphosat und andere Chemikalien geschützt werden. Denn nur so können wir das Vertrauen in unseren Honig und in unsere Arbeit bewahren. Regelmäßige Prüfungen von „Risiko-Honigen“ oder Verzicht auf Bienentransport auf solche Chemisch belastete Felder sind dabei ein unverzichtbarer Schritt, um die Qualität und Sicherheit unseres Honigs zu gewährleisten.
Zwischen Honig und Tod – Der lebensgefährliche Tanz der Honigjäger
In den abgelegenen Wäldern Nepals, Indiens und anderer Teile der Welt gibt es eine uralte Tradition, die so faszinierend wie tödlich ist: das Sammeln von wildem Honig. Männer klettern ohne moderne Sicherheitsausrüstung auf schwindelerregende Höhen von über 30 Metern, um an den begehrten Honig wilder Bienen zu gelangen.
Die Gefahr ist groß! Wackelige Bäume, physische Belastung, Nägel als Leiter, auch manchmal Hanfseile als Aufstiegshilfe und aggressive Bienenschwärme mit ständige Gefahr abzustürzen. Und das alles während die Wildbienen ständig und aggressiv angreifen! Doch warum nehmen diese Männer solche Risiken auf sich? Der Honig ist nicht nur eine Nahrungsquelle, sondern auch ein wichtiges Handelsgut, das oft überlebenswichtige Einnahmen für die Familien bringt. Gleichzeitig wird die Frage aufgeworfen, ob der Preis für den Honig zu hoch ist – denn manchmal wird er mit dem Leben bezahlt.
Das Video zeigt packende Geschichte, historische Hintergründe und Einblicke in die Kultur der Honigjäger. Die Honigjäger zeigen Mut, enorme physische und psychische Belastung, Tradition und den oft unsichtbaren Gefahren, die hinter einem scheinbar einfachen Produkt wie Honig stecken.

So überleben Bienen den Winter
Die Bienen versammeln sich eng um die Königin und bilden eine „Wintertraube“. Durch Muskelzittern erzeugen sie Wärme, um die Temperatur im Stock konstant zu halten (ca. 20–30°C im Inneren der Traube).Sie ernähren sich von den Vorräten, die sie im Sommer gesammelt haben – hauptsächlich Honig und Pollen.In der kalten Jahreszeit wird die Eiablage der Königin stark reduziert oder ganz eingestellt, damit weniger Energie für Brutpflege benötigt wird.Die äußeren Bienen wechseln sich mit den inneren ab, damit alle genug Wärme bekommen.Sobald es im Frühjahr wärmer wird (ab ca. 10°C), fliegen die Bienen wieder aus und beginnen, frischen Nektar und Pollen zu sammeln.

Wie die Honigbienen erkennen können, ob eine Blüte bereits besucht wurde?
1. Elektrisches Feld der Blüte
Blüten erzeugen ein schwaches elektrisches Feld, das sich verändert, wenn eine Biene Nektar entnimmt.
Honigbienen können diese elektrischen Veränderungen wahrnehmen und so erkennen, ob sich ein Besuch lohnt oder ob die Blüte bereits geleert wurde.
2. Duftspuren (Pheromone)
Bienen hinterlassen beim Sammeln Duftstoffe (Pheromone) auf Blüten.
Andere Bienen können diese Düfte wahrnehmen und meiden Blüten, die kürzlich besucht wurden.
3. Veränderungen im Nektargehalt
Bienen können mit ihren Antennen und Mundwerkzeugen (Tarsen & Rüssel) testen, wie viel Nektar noch in einer Blüte vorhanden ist.
Wenn eine Blüte wenig Nektar enthält, suchen sie lieber nach anderen Blüten.
4. Optische Hinweise
Manche Blüten verändern nach der Bestäubung ihre Farbe oder Muster, um Bienen zu signalisieren, dass sie bereits besucht wurden.
Bestimmte Pflanzen nutzen diesen Mechanismus, um Bienen effizienter zu lenken.
5. Lernverhalten
Bienen erinnern sich an besonders lohnenswerte Blütenarten und meiden ineffiziente Blüten, die oft leer sind.
Sie lernen durch Erfahrung, welche Pflanzenarten in welchen Zeitabständen wieder Nektar produzieren.

In Deutschland ist in den letzten Monaten ein erheblicher Skandal um gefälschten Honig aufgedeckt worden.
Untersuchungen des Deutschen Berufs- und Erwerbsimkerbundes ergaben, dass von 30 in deutschen Supermärkten getesteten Honigproben 25 mit billigem Zuckersirup gestreckt waren. Diese Fälschungen sind so raffiniert, dass sie selbst in Labortests schwer nachweisbar sind.
Methoden der Honigfälschung:
Zugabe von Zuckersirup: Eine gängige Methode besteht darin, Honig mit preiswertem Zuckersirup zu strecken, um die Produktionskosten zu senken und höhere Gewinne zu erzielen.
Verwendung von Reissirup oder künstlich hergestellten Enzymen: Diese neueren Fälschungsmethoden sind besonders schwer nachzuweisen und erfordern spezialisierte Analysemethoden.
Aktuelle Entwicklungen:
Der Imkerverband Rheinland-Pfalz hat aufgrund dieser Erkenntnisse Anzeige bei der Europäischen Kommission und Europol erstattet und fordert strengere Kontrollen sowie die Einführung neuer Analysemethoden, um solche Fälschungen zukünftig besser erkennen zu können.
Empfehlungen für Verbraucher:
Kauf beim lokalen Imker.
Um sicherzustellen, echten und unverfälschten Honig zu erhalten, wird empfohlen, Honig direkt bei lokalen Imkern zu erwerben.
Achten auf Herkunftsangaben.
Beim Kauf im Supermarkt sollte auf klare Herkunftsangaben geachtet werden. Die EU hat Anfang 2024 neue Vorgaben für die Herkunftskennzeichnung von Honig beschlossen, deren Umsetzung jedoch noch aussteht.
Die Problematik gefälschten Honigs betrifft nicht nur Deutschland, sondern den gesamten EU-Markt. Es ist daher wichtig, als Verbraucher bewusst einzukaufen und auf die Qualität sowie die Herkunft des Honigs zu achten.
Informationsquellen: Welt.de und Bild.de
